|
| |
Auerbach
einst und jetzt
 |
Das Wappen der
Stadt Auerbach in der Oberpfalz
und insbesondere der darin enthaltene Ur
ist schon seit Anfang des 15. Jahrhunderts
durch alte Siegel
nachweisbar.
Seine Beschreibung lautet: "In Gold
auf grünem Dreiberg schreitend
ein golden bewehrter schwarzer Auerochse,
der an einem roten Riemen
einen
gevierten Schild um den Hals trägt;
darin 1 und 4 in Schwarz ein rot
gekrönter
und rot bewehrter goldener Löwe,
in 2 und 3 die bayerischen
Rauten."
Die drei grünen Berge sind
der Überlieferung nach
Gottvaterberg,
Pinzigberg und Grünberg (Gaasberch).
(Basisdaten
von Auerbach; Website der Stadt;
Ehrenbürger) |
Der
Auerochse steht für den ersten Teil des Ortsnamens; der gevierte Schild zeigt
das wittelsbachische Herzogswappen, das gemeinsame Wappen der altbayerischen und
kurpfälzischen Linien des Hauses, und verweist auf die Zugehörigkeit zur
Oberpfalz und zu Bayern. Das Bild im Wappen basiert auf den zwei ältesten Siegel
von etwa 1401 und 1472 und wurde 1963 wieder angenommen, nachdem seit 1819 ein
anderes Wappen in Gebrauch war: Ein gevierter Schild enthielt in 1 und 4 einen
silbernen Schrägwellenbalken in Grün, in 2 und 3 die Vierung Silber/Blau.
Die 2. Silbe des Ortnamens Auerbach rührt vom Speckbach her, der bei
Zogenreuth nach dem Zusammenfluss von Dammels- und Fenkenwaldbach
so heißt, und dann durch unsere Stadt fließt.

Wie zahlreiche Funde (z.B. Keltengräber
bei Ortlesbrunn) aus
verschiedenen erdgeschichtlichen Epochen
wie Stein-, Bronze-, Urnenfelder-
und Eisenzeit belegen, siedelten schon sehr früh Menschen in unserer Gegend.
Große Anziehungskraft übte dabei sicher das in und um Auerbach anzutreffende
Eisenerz aus, das abgebaut und in zahlreichen Hammerwerken
verarbeitet wurde.
Als Bischof Otto der Heilige von Bamberg anno 1119 das Benediktinerkloster Michelfeld gründete, übergab er diesem fast alle Orte der Gegend, darunter
auch „Urbach“, das Dorf am Bach, an dem der Ur oder Auerochs häufig
anzutreffen war. Da den frommen Abt und seine Mönche der bald um das Kloster
entstandene Markt störte, ließen sie durch Bischof und Kaiser diesen 1144 von
Michelfeld nach Auerbach verlegen. Im gleichen Jahr wurde Auerbach
seelsorgerisch von der Mutterkirche Velden losgelöst und hier eine
eigenständige Pfarrei gegründet. Der hl. Jakobus war erster und ursprünglicher
Kirchenpatron; knapp 200 Jahre später wurde St. Johannes der Täufer neuer
Patron der Pfarrei Auerbach.
Mit der Umsiedlung der Michelfelder wurden um die Kirche etwa 120 Häuser
errichtet. So entstand der Grundriss von Auerbach, wie er sich heute noch fast
unverändert in der Altstadt zeigt.
Im 12. und besonders im 13. Jahrhundert entwickelten sich Erz- und
Eisengewinnung sehr günstig. Zugleich und deswegen wurden enge Geschäftsbeziehungen
zu den damaligen Handelsmetropolen geknüpft und weiter ausgebaut. Vor allem Nürnberger
Patrizierfamilien sind dabei zu nennen, die teilweise sogar hierher übersiedelten.
Aus Dankbarkeit für geleistete Waffenhilfe erhob Ludwig der Bayer wohl 1314
Auerbach zur Stadt.
Seit dem Hausvertrag von Pavia (1329) gibt es zwei Linien des Hauses
Wittelsbach, die bayerische und die pfälzische. Die Oberpfalz und damit auch
Auerbach gehörte fortan den pfälzischen Wittelsbachern, und kam erst im Jahre
1628 wieder zurück zu Bayern.
Pfalzgraf Rudolf II. (1306-1353) überließ seiner Tochter Anna bei der Heirat mit
dem späteren Kaiser Karl IV. (1347-1378; reg. 1355-1378) im Jahre 1349 als
Mitgift u.a. als Pfandwert die Orte Neidstein, Hartenstein, Velden, Plech und
Auerbach. Nach dem Tode Rudolfs (1353) kam Auerbach mit mehreren anderen Orten
durch Verkauf von Pfalzgraf Ruprecht I. endgültig an Karl IV. und damit an
Böhmen.
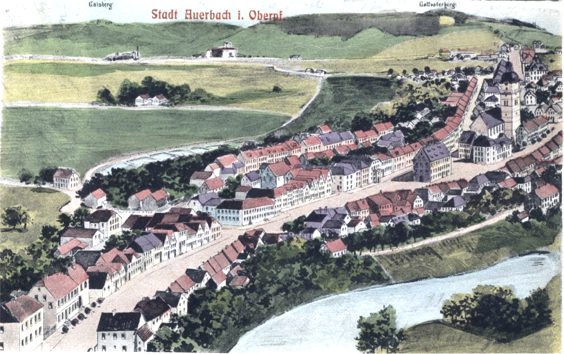
Auf
dieser Ansicht der Stadt Auerbach um 1900 ist z.B. der obere Teil des unter
Kaiser Karl IV. in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts angelegte große
Stadtweiher sehr schön zu sehen. In den ersten Jahren nach Ende des zweiten
Weltkriegs (1945) wurde damit begonnen, diesen Teil des Stadtweihers
aufzufüllen; die "Weiherstraße" entlang dem heutigen Park und
Spielplatz erinnert daran.
Auch die uralten Behälterweiher, die etwa 1955 verfüllt wurden, sind links zu sehen.
Von der mittelalterlichen Befestigungsanlage ist
leider fast nichts mehr erhalten geblieben.
Eine sehr große Bedeutung gewann die Stadt im 14. Jahrhundert während der
„Neuböhmischen Zeit“ unter Kaiser Karl IV. und seinem Sohn König
Wenzel.
1373 wurde Auerbach sogar die Hauptstadt dieses Territoriums mit eigenem Landgericht, welches mit kurzer Unterbrechung bis 1862 bestand. Karl IV. ließ
u. a. den großen Stadtweiher anlegen und das leider nicht mehr erhaltene Schloss
errichten. Unter König Wenzel bestand eine eigene Münzwerkstätte in
Auerbach, die allerdings nur wenige Jahre prägte. Auch das Bürgerspital
und die benachbarte Spitalkirche St. Katharina
stammen aus dieser Zeit.
Nach der Absetzung von König Wenzel eroberte am 23. September 1400
Ruprecht von der Pfalz das durch Brand
schon schwer beschädigte Auerbach.
 |
König Ruprecht (reg. 1400-1410)
gewährte den
Auerbachern
Steuerfreiheit zum Wiederaufbau der Stadt.
Sein Sohn Pfalzgraf Johann von Neumarkt
(1383-1443; reg. 1410-1443)
genehmigte 1418 den Bau
des Rathauses auf seinem heutigen
Platz. |
Wenige Jahre später, 1430, verwüsteten die Hussiten
den Ort nahezu vollständig. Die Bewohner hatten sich größtenteils durch die
unterirdischen Fluchtstollen in Sicherheit
gebracht. Lange Jahre des Wiederaufbaus folgten.
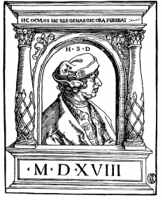 |
Heinrich Stromer,
später u. a. Rektor der Universität Leipzig,
kam in diesen
schweren Jahren
in unserem Auerbach zur Welt.
Dr. Stromer ist der Begründer
des weltbekannten Weinlokals „Auerbachs Keller“
in Leipzig. Durch Goethes
Drama „Faust“
hat der Namen unserer Stadt
auch Eingang in die Weltliteratur
erlangt. |
Während der Reformationszeit
im 16./17. Jahrhundert war die Stadt nahezu 100 Jahre lutherisch oder
kalvinisch, je nachdem welches Bekenntnis der jeweilige Landesherr hatte (cuius
regio, eius religio). Als Kurfürst Maximilian I. von Bayern 1628 die Oberpfalz
erhielt, mussten die Menschen wieder katholisch werden – oder auswandern.
Heute gehören über 90 % der Auerbacher Einwohner diesem Bekenntnis und der
Erzdiözese Bamberg
an. Die evangelisch-lutherische Gemeinde entstand
erst nach dem 2. Weltkrieg vor allem durch den Zugang der zahlreichen
Heimatvertriebenen.
Wie über die meisten Orte unserer Gegend brachte der „Dreißigjährige
Krieg“ (1618-48) auch über Auerbach großes Unheil und große Not.
Bayerische, kaiserliche und schwedische Truppen wechselten sich in der
Belagerung, in der Einnahme, in der Plünderung und Brandschatzung sowie in der
Verwüstung der Stadt und ihres Umlandes ab. Pestepidemien und andere Seuchen
taten ein Übriges.
 |
Im Österreichischen Erbfolgekrieg
fand im Mai 1703
beim nahe gelegenen Krottensee
eine größere Schlacht statt,
in deren Verlauf gefallene
Soldaten
in das sog. Windloch der heute weithin
bekannten Tropfsteinhöhle
Maximiliansgrotte
geworfen wurden. |
Im 19. Jahrhundert vernichteten mehrere Brände große Gebiete der Innenstadt.
Durch den Wiederaufbau verlor Auerbach zum Teil sein mittelalterliches
Aussehen.
Die Eisenwerksgesellschaft Maximilianshütte, kurz Maxhütte genannt, betrieb
fast ein Jahrhundert lang von 1878 bis 1987 hier in Auerbach Bergwerke; die Türme
der vorletzten (1904-78) und erfolgreichsten Grube Maffei im Ortsteil Nitzlbuch
bleiben als Industriedenkmal für spätere Generationen erhalten.
 |
 |
Nicht
zuletzt auf auf Drängen der Maxhütte wegen des Erztransports wurde
eine Lokalbahnstrecke von Auerbach nach Ranna erbaut und am 16.12.1903 in
Betrieb genommen. Im Februar 1970 verkehrte hier leider der letzte
fahrplanmäßige Zug. Der letzte "Sonderzug" beförderte am 23.
Mai 1982 etwa 700 Pilger von Auerbach nach Altötting und zurück. Die
Auerbacher Eisenbahnära währte knapp acht Jahrzehnte. Der
"Auerbacher Bockl" (Foto oben rechts) ging in den
Ruhestand. Die Stadt Auerbach
erwarb das gesamte Bahngelände, sanierte das Stationsgebäude (Foto
oben Mitte) und
richtete kurz vor der Jahrtausendwende im ehemaligen Lokführerhaus und im
dazugehörigen Lokschuppen den Jugendtreff "Lo(c)kschuppen" ein.
In den Jahren 1936-39 wurde der seit 1907 bestehende Truppenübungsplatz Grafenwöhr
auf rund 24.000 ha erweitert. Durch diese Maßnahme verlor Auerbach einen Teil
seines Hinterlandes, einst blühende Orte wie z.B. Ebersberg,
Hopfenohe,
Pappenberg und Dornbach wurden aufgelöst
und deren Bewohner umgesiedelt.
|
In den Jahren 2004 und 2005
wurde durch
umfangreiche Maßnahmen
der Erhalt der Ruine der
"St. Peter und
Paul" Kirche
von Hopfenohe gesichert.
Der spätere Auerbacher Pfarrer
Johann Ritter
hatte sie 1934
kurz vor der Ablösung des Ortes
grundlegend sanieren lassen.
(Foto 2009) |
 |
Nach dem II. Weltkrieg kamen zahlreiche Heimatvertriebene hierher und sorgten
mit dafür, dass es wieder aufwärts ging; im Flüchtlingslager Bernreuth
fanden viele eine zumindest vorläufige Bleibe. Auerbach übernahm schon 1956 die
Patenschaft über die Bewohner der ehemaligen sudetendeutschen Bergstadt
Schlaggenwald im Egerland.
In der Stadt selber entstanden u. a. ein Schulzentrum mit Grund- und
Mittelschule (bis 2010
"Hauptschule")
mit weitläufigen
Sportanlagen, Kindergärten, Alten- und Pflegeheime, das Mutterhaus der Schulschwestern
und deren Realschule, das Kreiskrankenhaus (heute
St.-Johannes-Klinik), sowie
zahlreiche Sportstätten und ein sehr schönes Freizeitbad. Dies alles gibt dem
historisch gewachsenen Ort ein zeitgemäßes Gepräge.
Durch die Schaffung mehrerer Siedlungsgebiete in allen Ortsteilen hatten und haben Auerbacher und
Zuzugswillige die Möglichkeit zum Bau von Eigenheimen, die Ausweisung und
Erschließung von Industriegebieten sicherte bestehende und schuf neue Arbeitsplätze,
wie z.B. beim größten Arbeitgeber Cherry
(seit Nov. 2008 ZF
Electronics;
seit 2016 GENUI Partners; 2019 Umzug ins Industriegebiet Saas; NN, SRZ)
Bis 1972 gehörte Auerbach zum Landkreis Eschenbach,
seither zu Amberg-Sulzbach; im gleichen Jahr kam
die Ortschaft Ranna zur Stadt. Bei der Gebietsreform 1978 wurden die Gemeinden
Degelsdorf, Gunzendorf,
Michelfeld, Nasnitz, Nitzlbuch und
Ranzenthal nach
Auerbach eingegliedert. In der Stadt leben heute auf ca. 7.000 ha Fläche etwa
9.000 Menschen.
Neben der schon erwähnten Patenschaft über die ehemaligen Schlaggenwalder Bürger
hat Auerbach seit 1963 ein weiteres „Patenkind“, nämlich das Minensuchboot
Neptun der Bundesmarine, dessen Nachfolger 1990 in Dienst gestellt wurde und Auerbach/OPf. heißt.
 |
Seit 1985 besteht eine enge Partnerschaft
mit der französischen
Stadt Laneuveville devant Nancy.
Bei der 20-Jahrfeier im Oktober 2005
wurde der neu gestaltete ehemalige
Schwemmweiher
in Place de Laneuveville
umbenannt.
|
1997 beschloss der Auerbacher Stadtrat auf
Bitten der polnischen Gemeinde Oświęcim, wie
der unter den Nazis
im sog. 3. Reich "Auschwitz"
genannte Ort heute wieder heißt,
offiziell „eine freundschaftliche Zusammenarbeit“ zwischen beiden Städten.
Eines der Ergebnisse daraus ist der Schülerautausch
der hiesigen Mittelschule
mit zwei Gymnasien in Oświęcim.
Im sozio-kulturellen Bereich sind es vor allem die über 70 Vereine, Verbände
und sonstigen Organisationen, die mit einer breiten Palette von Angeboten in
allen Ortsteilen jüngeren und älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern
Ausgleich zur Alltagsbeschäftigung ermöglichen. So gibt es allein sieben
Sportvereine und Tennisclubs, einen Versehrtensportverein, fünf Schützenvereine,
einen Ski-, einen Motorsport- und zwei Reitclubs, um ein paar Beispiele für den
sportlichen Sektor zu geben. Einige starke Musikkapellen und mehrere Chöre und
Gesangsgruppen im weltlichen und im kirchlichen Raum mögen stellvertretend für
den musischen Bereich stehen.

Die
größte Musikgruppe ist die 1959 gegründete Knabenkapelle, die älteste und
traditionsreichste die seit 1902 bestehende Bergknappenkapelle. Während
"die Speckbachtaler" noch bestehen, existieren der Spielmannszug der
Kolpingsfamilie und die Schützenkapelle (s. Foto) leider nur mehr in der
Erinnerung.
Nicht unerwähnt bleiben sollen im
kulturellen Sektor auch der Theaterverein, der Heimat- und Volkstrachtenverein
und der Förderverein Maffeispiele.
Von
den Traditionsvereinen seien der Bergknappenverein, die Soldaten- und
Kriegerkameradschaften und der Kanonierverein Weidlwang genannt. Acht
freiwillige Feuerwehren, ASB, BRK und Wasserwacht helfen, wann immer Not am Mann
ist. In mehreren Vereinen wird das Hobby der Tierzucht gepflegt. Sehr rührig
sind auch die Sportangler, die Faschingsgesellschaft Stadtgarde, die
Naturfreunde, die Kolpingsfamilie und die Verkehrswacht. Zu Interessenverbänden
zusammengeschlossen haben sich z.B. die Haus- und Grundbesitzer,
die Kriegsopfer, die Ruhestandsbeamten, die Gewerbetreibenden, die Jäger und
die sudetendeutschen Heimatvertriebenen. Alle Gruppierungen hier aufzuführen würde
sicher den vorgegebenen Rahmen sprengen. Die meisten der Auerbacher Vereine,
Verbände und sonstigen Organisationen aus allen Ortsteilen haben sich 1978 im
Stadtverband zusammengeschlossen, der u. a. größere Veranstaltungen wie das
alle zwei Jahre stattfindende Bürgerfest organisiert, und seit Januar 1979
monatlich im Auftrag der Stadt den „Auerbacher Stadtanzeiger“ herausgibt.
|
Zu den Sehenswürdigkeiten Auerbachs
gehören u. a.
die katholische Pfarrkirche
St. Johannes der Täufer
mit dem wohl weltweit einzigartigen
Eisenerzaltar dort (Foto),
die renovierte Friedhofskirche St.
Helena,
die
Spitalkirche St. Katharina
in der Unteren Vorstadt
und der Sitzungssaal im
Rathaus. |
 |
Im Ortsteil Michelfeld sind besonders bemerkenswert die Friedhofskirche
St. Leonhard, die von den Geschwistern Asam ausgestaltete Pfarrkirche St.
Johannes der Evangelist und die gesamte weiträumige Klosteranlage,
in der heute von der Regens-Wagner-Einrichtung alte und behinderte Mitmenschen
gepflegt werden.
Auerbach kann mit Recht „Stadt im Grünen“ bezeichnet werden, denn über 90
% des Gemeindegebietes sind Wälder, Felder und Wiesen. Mehrere gut ausgebaute
und ausgeschilderte Fuß- und Radwanderwege (z.B. Bürgerwald,
Mühlenweg, Erzweg) ermöglichen Touren in die nähere
und weitere Umgebung, Wirtshäuser inmitten der Naturlandschaft wie Rußhütte,
Hohe Tanne, Sackdilling, Grottenhof oder
Steinamwasser laden zu Rast und
Brotzeit ein.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch das vor wenigen Jahren
geschaffene Naturschutzgebiet Leonie, in dem u. a. Auerochsen angesiedelt wurden,
die vor Jahrhunderten der Stadt den Namen gaben.
Seit September 2007 steht ein
überlebensgroßer Ur aus Bronze auf dem Unteren Markt der Stadt Auerbach vor der
Sparkasse.
|
Für ´s Familienalbum:
das obligatorische
"Gruppenbild mit Auerochs"
bei der Übergabe
Ende September 2007.
(Quelle) |
 |
1k.jpg) |
Der Brunnen auf
dem
oberen Marktplatz
stammt vom gleichen Künstler
wie der Auerochs, nämlich von
Dominik Dengl
(Malching am Inn).
Der Brunnen wurde
im September 2009
eingeweiht.
Er steht etwa an gleicher Stelle,
wie jahrhundertelang
der Marktplatzbrunnen. |
Die Altstadtsanierung ist inzwischen
weit fortgeschritten. Schlosshof, Oberer Marktplatz und Unterer Markt, sowie die
Pfarrstraße sind längst fertig. Im November 2013 konnte die
Dr.-Heinrich-Stromer-Straße
wieder frei gegeben werden. Das Rathaus war 2017-2019
"dran".

Die 700-Jahrfeier
der Stadterhebung wurde verteilt über das ganze Jahr 2014 begangen.

Im Juni 2012 eröffnete die Stadt Auerbach
gleich zwei Museen:
 |
das Museum 34
im renovierten Burgerhaus - heute Bürgerhaus - ist ein nicht
alltägliches Heimatmuseum |
 |
das Lodes-Museum im sog.
Schenklhaus (Oberer Marktplatz 17) zeigt Gemälde und Grafiken
des aus Auerbach stammenden Künstlers Rudolf Lodes. |

letzte Bearbeitung dieses Artikels am 17. Februar
2024

 |
Wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen möchten,
können Sie mich hier
erreichen
oder telefonisch unter 09643 683.
|
 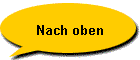   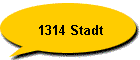 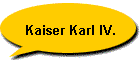  
|