|
| |
Ehemalige
Eisenhämmer
unserer Gegend
Vom Eisen und vor allem von seiner Verarbeitung im Gebiet der heutigen Stadt
Auerbach zeugen auch die zahlreichen Hammerwerke, von denen Überreste
an vielen Stellen noch zu sehen sind: Ligenz,
Steinamwasser,
Staubershammer, Hämmerlmühle, sowie einige an der
Pegnitz.
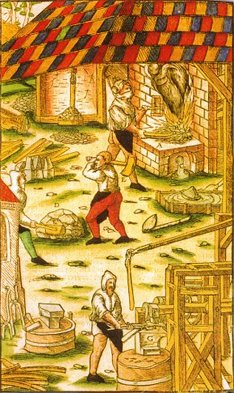 |
Georg Agricola,
der große Montanwissenschaftler aus Sachsen,
beschrieb 1556 auch ein
Hammerwerk
und seine Funktionsweise in seinem
aus 12 Büchern bestehenden
Werk
„Vom Berg- und Hüttenwesen“ sehr genau.
Zu diesem Bild aus Band IX:
Im Hintergrund sieht man den Rennherd,
davor wird eine Luppe
(siehe Anmerkung weiter unten)
grob von Schlackeresten befreit.
Ganz im
Vordergrund geschieht das
Ausschmieden der Luppe unter dem Hammer.
(aus 1,
Seite 365)
"Luppe: Heißer Eisenklumpen
von teigiger
Konsistenz aus einem Rennofen
oder aus dem Herd einer Frühschmiede.
Die Luppen wurden zu stabförmigem Eisen
(Stahl)
ausgeschmiedet, wobei dieser Produktionsschritt
auch dafür sorgte, daß
(insbesondere bei Luppen aus Rennöfen)
die im Eisen eingeschlossene Schlacke
ausgehämmert wurde." (Quelle) |
Am
Freiberger
und im Frohnauer Hammer
in Sachsen, in Hexenagger
(Naturpark Altmühltal) oder andernorts,
kann man die Wirkungsweise eines früheren Hammerwerkes in
eindrucksvoller Weise beobachten.


Ligenz und
Steinamwasser
Der Hammer Ligenz, am Goldbrunnbach vom Stadtkern aus gesehen im Nordosten
gelegen, hatte lt. Hammereinungsurkunde von 1387 damals als Besitzer einen Hans
Streber, wohl aus Nürnberg stammend. Schlackenfunde, die auch heute noch
gemacht werden, weisen auf eine rege Tätigkeit hin. Bis ca. 1954 war eine Mühle
in Betrieb.
In Steinamwasser erinnern auf einem Felsen Mauerreste an die ehemalige Burg, zu
der auch ein Hammer gehörte. Schon in der Gründungsurkunde des Klosters
Michelfeld 1119 wird Steinegewazzer aufgeführt, und ein Syboto von
Steinigewasser ist Mitunterzeichner der Urkunde, mit der 1144 Markt und Pfarrei
Auerbach bestätigt werden. Auch diesen Hammer hatten zeitweise die Streber in
Besitz, und ein Ulrich Stromer betreibt ihn 1431-49. Von 1513-1712 gehört der
Hammer der Stadt Auerbach, und um 1723 schließlich erfolgte die Umwandlung in
eine Mühle.
In Steinamwasser fließen der Goldbrunnbach und der von Ortlesbrunn
her kommende Ortlesbach zusammen und
bilden nun den Flembach. Dieser durcheilt ein landschaftlich sehr schönes Tal,
in dem die Flembachhütte
der Naturfreunde zum Verweilen einlädt. Kurz vor Michelfeld vereinigen sich der
Flembach und der von Auerbach durch das "Felsländl" her kommende Speckbach.


Staubershammer
Mit seinem Wasser betrieb der Flembach bzw. ein nördlich davon abgeleiteter
Seitenarm (BayAtl) bis ca. 1951 den Staubershammer, der 1973
abgebrochen und im Bergbau- und Industriemuseum (heute
Kulturschloss Theuern) als
Außenanlage wieder aufgebaut wurde.

Der Schien- und Blechhammer Ziegelmühle (tziegelmül, tziegelhamer) wird
wohl erstmals 1387 genannt. Er dürfte aber mindestens 100 Jahre vorher von der
nahen
Burg
Festenberg
aus errichtet worden sein.
Zeitweilig gehörte er den Streber und war lange Jahre auch beim Kloster
Michelfeld.
Oberhalb des Hammers stand im Mittelalter die Burg Festenberg,
von der heute nur mehr sehr spärliche Überreste auf dem Burgfelsen existieren.
1438 verkauften Nürnberger Bürger den Hammer Zigelmül an das Kloster
Michelfeld. Mindestens seither ist der Hammer dem Kloster abgaben- und
zehentpflichtig.
Mit dem Tod des Abtes Friedrich von Aufsess (reg. 1546-1558) am 3. März 1558
hörte das Kloster Michelfeld für ca. ein Jahrhundert praktisch auf zu
existieren.
 |
Ein Blick
in das Innere
des früheren Staubershammers.
(Archiv Schäff) |
1561 erwarb das Hammeranwesen ein Georg Stauber, und
seither hat es seinen Namen "Staubershammer"; vorher hieß es nämlich Ziegelmühle.
1601 kaufte die Stadt Auerbach von Hans Stauber den Staubershammer für 1.850
Gulden und 100 Gulden Leikauf. Sie veräußerte diesen Schleifhammer bereits 1618
wieder und zwar an Johann Erasmus Kotz. Die Stauber waren weiterhin die
Hammermeister.
Im 30jährigen Krieg (1618-1648) wurde unsere Gegend mehrfach von den
verschiedenen Truppen heimgesucht.
1661 kamen wieder Benediktiner aus Oberalteich in das nahezu verwüstete Kloster
Michelfeld, das 1669 dem Orden wieder übergeben und 1695 wieder Abtei wurde.
Dadurch kam u.a. der Staubershammer wieder ans Kloster, das ihn zunächst an die
Grüner von der Pfannmühle verpachtetete.
1750 nahm das Kloster seinen Besitz Staubershammer in eigener Regie und
errichtete eine Zehentscheune für das von den Klosteruntertanen der Umgebung
abzuliefernde Getreide.
Nach einem Großbrand auf dem Staubershammer von Ende Januar 1796 ließ ihn das
Kloster 1799 wieder aufbauen. Vermutlich wurden dazu die Überreste der Burg
Festenstein verwendet.
Im Zuge der Säkularisation wurde das Kloster Michelfeld am 23. April 1803
aufgelöst, und sein Eigentum ging an den Staat über.
Im Frühjahr 1805 ersteigerte Johann Götz,
Maurergeselle und ehemaliger Klosterbote aus Michelfeld das
gesamte Anwesen Staubershammer um 10.100 Gulden. Er veräußerte im gleichen
Jahr das Hammerwerk an Jakob von Sonnenburg.
 |
1805 ist Jakob
Falkner von Sonnenburg
der Hammerherr; er wurde 1818
Bürgermeister von
Auerbach.
Seine Grabplatte findet man
an der östlichen Außenwand
der Friedhofskirche
St. Helena (Auerbach),
sein Wappen Foto) an der rechten Seite
des Sitzungssaales im Rathaus der Stadt. |
Johann Götz (+1820) blieb mit seiner Familie im Haus Nr.
2
in Staubershammer; es war das frühere Taglöhnerhaus. Im gleichen Jahr 1820 übergab
die Witwe Magdalena Götz das Anwesen Staubershammer 2 an ihren Sohn Friedrich
(+1859). Dieser hatte zusammen mit seiner Frau Margarethe (+1858) sechs Kinder:
Paulus, Georg, Barbara, Kunigunde, Theres und Maria. Sie traten das Erbe an und
blieben zeitlebens ledig. Die vier Schwestern waren mit den zwei Brüdern ein
Herz und eine Seele und führten ein Muster-Familienleben.
 |
Paulus Götz
war ein geschickter Schreiner
und Orgelbauer.
Eines seiner Werke
steht in der Kirche
St. Maternus
in Motschenbach,
(2)
Dekanat Kulmbach.
(Foto S. Witzgall)
1856 hat Götz eine
Vorgängerin der heutigen Orgel
in der Kirche St. Ägidius
in Gunzendorf geschaffen. |
"Die älteste erhaltene Götz-Orgel von 1869 steht in der
Simultankirche von
Kürmreuth." (2, Seite 12)
Da die Geschwister Götz sehr fromm waren und keine Erben
hatten, vermachten sie ihr Anwesen später der 1884 in den Räumen des
ehemaligen Klosters Michelfeld gegründeten Taubstummenanstalt, heute
Regens-Wagner.
(3, Seite 221f)
f.jpg)
"Die fünf unverheirateten Götz-Geschwister Georg, Kunigunda, Barbara,
Theresia und Maria stifteten ihre aus dem früheren Klosterbesitz
stammenden und von ihrem Großvater Johann 1805 ersteigerten Grundstücke
usw. in Staubershammer zum Erhalt der ehemals benediktinischen
Klosteranlage."(3, S. 222)
Dieses
schöne schmiedeeiserne Kreuz mit den Schrifttafeln erinnert auf dem
Klosterfriedhof an diese und einige andere Wohltäter.
Am 18. Oktober 1882 erwarb Johann Gummermann, 1844 in Waffenhammer, Gemeinde
Wildenstein geboren, den Staubershammer um 6.500 Mark. Er betrieb ihn als
Eisenhammer und betätigte sich auch als Blattgoldschläger. Zehn Jahre später
verkaufte er das Anwesen wieder und folgte seinem Sohn Basilius zusammen mit
seiner Frau Anna und weiteren fünf seiner insgesamt elf Kinder nach Amerika.
Gummermann lebte in Milwaukee/USA und starb am 21.12.1915. (Quelle: Helmut Gummermann, über Horst Degelmann, Ködnitz)
Seit diesem Jahr 1892 gehört
der Staubershammer der Familie Schäff, die 1895 auch das seit 1805 abgetrennte
Anwesen Nr. 2 erwarb.
Der Hammer wurde
bis 1951 betrieben und es wurden hauptsächlich
Äxte, Pflugscharen usw. hergestellt. Der damalige Besitzer des Anwesens Paul Heinz Schäff
(1927-2024) setzte
sein Hammerwerk 1963 nochmals in Gang, um das Turmkreuz für die Michelfelder
Asamkirche vorzuschmieden.
 |
Heute lädt
Familie Schäff
bzw. Deinzer
zu einem Besuch
auf den
idyllisch gelegenen
und sehr gepflegten
Staubershammer ein.
Sie betreibt eine Pension
mit
Ferienwohnungen.
(Foto Juni 2009) |


Hämmerlmühle
Ebenfalls am Flembach
liegt der
ehemalige Schleifhammer, heute
Hämmerlmühle genannt.
Besitzer war schon im 13. Jahrhundert und in den folgenden zeitweilig immer
wieder das Kloster Michelfeld.
Von der ehemaligen Bedeutung zeugt folgende
Episode: 1592 übernahm Hans Stauber, ein Bruder des oben beim Staubershammer genannten Georg, eine
Waffenlieferung für den Kurfürsten nach Neumarkt. Dort wollte dieser den lutherischen Bürgern
den Calvinismus mit „gebührendem Nachdruck“ beibringen. Der
Transport kam aber nur bis Amberg, wo dem Staubershammerer die Wagenladung von den
dortigen Bürgern abgenommen wurde.

1904 erwarb die Familie Looshorn das Anwesen und betrieb bis
1958 die Mühle, von der Teile dem Museum Theuern überlassen wurden.
Heute kann
man in der Hämmerlmühle sozusagen auf historischem Boden in der gepflegten Pension
"Ferienhof
Hämmerlmühle" seinen Urlaub verbringen. Die Pension wird von Anita März,
geb. Looshorn, betrieben.



Ehemalige
Hammerwerke an der Pegnitz
 |
Die nebenstehende
alte Zeichnung von 1522/23
zeigt von oben
nach unten
dem Lauf der Pegnitz nach
die drei an dieser gelegenen Hämmer
Fischstein,
Rauhenstein
und Ranna. |
Fischstein und Rauhenstein
An der Pegnitz lag der Hammer Fischstein, der im Salbuch von 1326 als „malleum
Pognerinne“, also als Hammer der Pognerin aufgeführt ist. Grundherrschaftlich
gehörte er lange Zeit zum Kloster Michelfeld, aber auch die Stromer und die
Sulzbacher Familien Loneisen und Zeller traten als Hammerherren auf. Der Ort
Fischstein, und damit die Überreste des Hammers, wurde in den letzten Jahren
abgelöst und dem Erdboden gleichgemacht, da er in der unmittelbaren
Wasserschutzzone der Stadt Nürnberg lag.
Vom ehemaligen Hammer Rauhenstein, der pegnitzabwärts folgt, stand bis vor
wenigen Jahren noch das Hammerhaus, ein zweigeschossiger Walmdachbau, allerdings
zum Schluss schon sehr herunter gekommen (1987 abgebrochen).
 |
Den Hammer Rauhenstein hatte
1410 Heinrich Stromer gegründet.
Das Kloster Michelfeld besaß ihn dann
längere Zeit,
und die Stadt Auerbach schließlich betrieb das Werk 1580-1626.
In der Nähe sollen im Jahr 1626
10.000 Soldaten der sächsisch - lauenburgischen Fürsten
ein großes Heerlager eingerichtet und
die Hämmer Fischstein und Rauhenstein
ausgeplündert und weitgehend zerstört haben. |
Am 23. Mai 1641 schließlich
brannte der Hammer Rauhenstein völlig ab. Im Jahre 1700 errichtet die Stadt
Auerbach an der Brandstätte eine Mühle, die ihr aber das Kloster Michelfeld
streitig machte. Nach mehreren Prozessen fiel Rauhenstein schließlich 1733
gegen eine Entschädigung von 2.500 Gulden endgültig an das Kloster. Dessen Abt
Heinrich Harder (1721-38) ließ 1736 sein Wappen über dem Eingang des
Hammerhauses anbringen.


Ranna und das Magdalenenkirchlein
Der letzte Hammer auf heute Auerbacher Grund an der Pegnitz war Ranna. König Wenzel
von Böhmen ließ ihn 1391 errichten; dies war also in der Zeit, als Auerbach
die Hauptstadt von Neuböhmen war (1373-1400). Immerhin 1530-1859 war der Hammer
im Besitz der Stadt Auerbach, die ihn mit wechselndem Erfolg verpachtete oder
selbst bewirtschaftete. So hatte ihn z. B. 1805-17 der schon beim Staubershammer
angeführte Falkner von Sonnenburg in Pacht. 1859 übernahm der Staat das
Hammergut. Die Kaufsumme, 80.750 Gulden in Silber, musste der Auerbacher Bürgermeister
Leonhard Neumüller am 21. Juni 1860 persönlich in Regensburg abholen. Der
Staat verkaufte das Anwesen weiter an einen Fr. Rauh aus Zogenreuth, der eine
Kunstmühle und ein Sägewerk daraus machte. Auf diesem Gelände stand dann
mehrere Jahre eine Wellpappenfabrik, ehe die damalige EWAG
Nürnberg (heute N-ENERGIE) als neuer Grundeigentümer die
Gebäude abbrechen ließ.
Aus der Hammerzeit Rannas ist aber noch ein weiteres Andenken vorhanden, nämlich
die Magdalenenkirche an der Staatsstraße nach Neuhaus.
Die hl. Magdalena ist
nach alter Tradition eine Patronin der Hammerschmiede, und so war ihr zu Ehren
schon sehr früh in Ranna ein Kirchlein errichtet worden. In den Wirren des 30jährigen
Krieges (1618-48) wurde es arg mitgenommen.
 |
Da auch eine gründliche
Renovierung
nicht den
gewünschten Erfolg brachte,
ließ der Auerbacher Pfarrer
Johann
Friedrich Trettenbach (1722-1772),
Sohn eines Schmiedemeisters
aus Neuhaus,
1742/43
das neue Kirchlein erbauen.
Mit der Errichtung des
Hochaltars (Foto 2009)
beauftragte er den Auerbacher
Bildhauer Johann M. Doser,
der das altehrwürdige Bild
der hl. Maria
Magdalena
aus der ursprünglichen Kapelle
mit verwendete.
|
Viele Jahre zogen um
den 22. Juli große Prozessionen aus den Orten der Umgebung nach Ranna. Seit
einiger Zeit findet am Namenstag der Heiligen wieder ein Magdalenenfest in Ranna
statt.
Damit
endet zwar der Rundgang durch die ehemaligen Hammerwerke auf dem Gebiet der
heutigen Stadt Auerbach i.d.OPf., doch der
aufmerksame Sucher wird sicher weitere Zeugnisse für den Bergbau und die
Eisenverarbeitung in alter und neuer Zeit hier in der Gegend entdecken.
Wer mehr über die Oberpfälzer Montangeschichte erfahren und vor allem erleben
möchte, dem seien ein Besuch im Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern Theuern
und eine Wanderung
auf historischen Wegen empfohlen.

verwendete
und weiterführende Quellen
| 1 |
Agricola, Georg,* De re metallica libri IX, Basel 1556;
deutscher dtv-Reprint, 1994 |
| 2 |
Hemmerlein, Andreas, Segnung der
restaurierten Paulus-Götz-Orgel ... in der Kirche St. Maternus zu
Motschenbach, Festschrift 2016 |
| 3 |
Weber, Rudolf, 900 Jahre Kloster
Michelfeld, Auerbach 2019 |
* "Der Glauchauer Handwerkerssohn Georg
Pawer, der sich nach Humanistenbrauch später Georgius Agricola
nannte, wurde mit seinem Hauptwerk De re metallica libri XII zum Begründer
der Montanwissenschaften." (Quelle)
Agricolas (1494-1556) Werk erschien ein Jahr nach seinem Tod in
lateinischer Sprache, ein Jahr später folgte die erste deutsche Übersetzung.

 |
Hobellied |
letzte
Bearbeitung dieses Artikels
am 12. Dezember 2025
|
 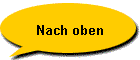 |