|
| |
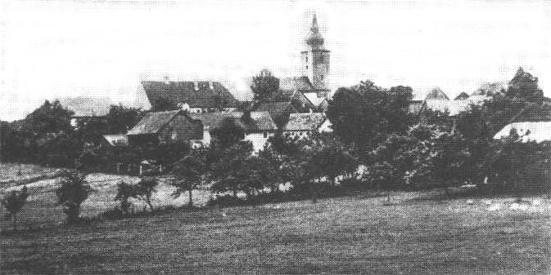
Hopfenohe
Das
Dorf Hopfenohe lag (BayAtl) gut 4 km ostwärts von Auerbach
(Marktplatz ca. + 435 m NN) auf einer ca. 556 m über dem Meeresspiegel
liegenden Anhöhe des Oberpfälzer Juras. Wegen seiner Hochlage war der Ort
bekannt für sein raues Klima und seinen Schneereichtum.
Bei der Ablösung 1939 zählte die politische Gemeinde, die nur aus der Ortschaft
Hopfenohe selber bestand, immerhin ca. 200 Einwohner mit 26 Hausnummern: je eine
Metzgerei, Schreinerei, Schneiderei, ein Kramladen und zwei Wirtshäuser
(Nr.
6 beim Strauß und Nr. 7 beim Schwedn)
versorgten die Menschen.
Die uralte Pfarrei
Hopfenohe umfasste zum selben Zeitpunkt drei
Schulbezirke (Hopfenohe, Unterfrankenohe und Dornbach)
und eine Filialkirche in Dornbach.

Heute sind praktisch nur noch der Vermerk „Dorfstelle Hopfenohe“ (BayAtl) und ein
Sperrgebiet von wenigen Quadratmetern rund um die Kirchenruine auf der Landkarte
des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr die einzigen „amtlichen Zeichen“, die
an Hopfenohe und seine weit zurückreichende Geschichte erinnern. (Luftbild)
Älteste
Spuren des Ortes
Der Name „Hopfenohe“ deutet darauf hin, dass der Ort schon vor dem Jahre
1000 entstanden sein muss, denn nur etwa bis zu diesem Zeitpunkt wurde das
althochdeutsche Wort „aha“ für einen Wasserlauf verwendet. Unser Hopfenohe
heißt z.B. in der Gründungsurkunde des Klosters Michelfeld von 1119 „Hopfenahe“,
also der Bach, an dem Hopfen (vielleicht wilder?) wächst. Nach der
Jahrtausendwende entstanden hätte der Ortsname wahrscheinlich die Endung „-bach“
erhalten.
Welcher Wasserlauf für den Ortsnamen Pate stand, ist nicht ganz klar.
Vielleicht bestand der Bach bei der Gründung auch schon gar nicht mehr, denn
die älteste überlieferte Schreibweise aus dem 11. Jahrhundert heißt
„Hopfenalte“, und unter „alte“ verstand man früher etwa „gewesenes
Wasser, Altwasser“. Vielleicht war aber auch gar kein Bach gemeint, sondern
der „See“ hinter der Schmiede (Hausnummer 13),
zuletzt nur mehr eine größere Pfütze. Vor etwa 200 Jahren soll die dazugehörige
Quelle noch ergiebig geflossen sein. Der Abfluss schließlich mündete in den
„Teufelsgraben“.
Tatsache ist, dass Hopfenohe an der großen europäischen
Wasserscheide Rhein-Donau liegt, die von Neuzirkendorf über
Oberfrankenohe kommend nach Bernreuth, Ziegelhütte, Funkenreuth und Königstein
führt und entscheidet, ob ein Wasser ins Schwarze Meer oder in die Nordsee fließt.
Hinweise
auf diese Wasserscheide
sind u. a.
diese alte Steinsäule
bei Hopfenohe (im
Hintergrund
die Ruine der Kirche)
und ein neues Verweisschild
an der B 470
auf der Höhe
bei Altzirkendorf.
 |
Wasserscheidensäule
Einsam die Säule steht,
an der keiner
außer Soldaten
vorübergeht,
an der keiner
außer Geistern
vorüberweht.
(Leonore Böhm, Grafenwöhr) |
Man
darf getrost annehmen, dass Hopfenohe mit zu den ältesten Orten unserer Gegend
zählt, wohl schon bestand, als im 6. und 7. Jahrhundert vereinzelt die Wenden hier
siedelten, und vielleicht im 9. Jahrhundert fränkischer Rittersitz wurde.
Die
Grafen von Hopfenohe
Karl der Große (ab
771 Frankenkönig, 800-814 römisch-deutscher Kaiser) hatte 788 auf dem Nordgau
und in Ostfranken Markgrafschaften errichtet, um die slawischen Eindringlinge
aufzuhalten.
Durch das Lehns- und Feudalwesen wurden die inneren Verhältnisse geordnet, und
auf dieser Basis das Christentum eingeführt.
Kaiser Heinrich
II. (ab 1002 deutscher König, 1014-1024 römischer Kaiser) zertrümmerte
die beiden Markgrafschaften und verwendete ihre besten Güter zur Gründung des
Bistums Bamberg
am Allerheiligentag des Jahres 1007. Am 6. Juli 1008 kam Hopfenohe zusammen mit
Auerbach und anderen Orten an das Hochstift Bamberg. Es wurde Bestandteil der
sogenannten „Truchsessischen Lehen“, die vom Bamberger Bischof den
Grafen
von Kastl und Sulzbach übertragen wurden.
Graf
Friedrich III. von
Hopfenohe, Pettendorf (bei Regenstauf) und Lengenfeld (Burg-Lengenfeld)
entstammte der Kastler Linie. Er hatte im Raum Auerbach eine stattliche Anzahl
von Lehnsgütern des Hochstifts Bamberg. Seine Gemahlin Hedwig hatte ihm zwar
zwei Töchter, Heilika und
Heilwig (Heilwic), geboren, aber keinen Sohn, der allein für
die Erbfolge eine Rolle spielte.
Graf Friedrich wollte in Ensdorf im
Vilstal ein "Hauskloster" errichten, das später ihm und seiner Familie
als Grablege
dienen sollte.

Kloster Ensdorf
Nach dem frühen Tod Friedrichs 1119 mit knapp 50 Lebensjahren führte sein Schwiegersohn Pfalzgraf
Otto
von Wittelsbach (ca. 1090-1156), der mit Tochter Heilika verheiratet war, das
Vorhaben der Klosterneugründung aus. Er wurde dabei tatkräftig unterstützt von
Bischof Otto von Bamberg, der mit großzügigen
Dotationen zur Ausstattung des schließlich 1121
gegründeten Klosters Ensdorf beitrug.
 |
Das Kloster
Ensdorf
wurde 1121 gegründet,
und von Bischof Otto I. (amt. 1102-1139),
dem Heiligen von Bamberg
wie das von ihm 1119 gegründete Michelfeld
den Benediktinern übergeben.
435 Jahre später wurde unter
Kurfürst Ottheinrich
1556
der katholische Ritus verboten
und Ensdorf - wieder wie Michelfeld -
aufgehoben.
|
Am 23. Juli 1669 übergab Kurfürst
Ferdinand
Maria die alten, teilweise maroden Klostergebäude den
Benediktinern aus
Prüfening.
Das klösterliche Leben in Ensdorf begann erneut zu blühen. 1694 begannen die
Mönche mit dem Neubau von Kloster und Kirche, im Jahr darauf wurde Ensdorf
wieder eigenständige Abtei.

1711 begann der Innenausbau der
Kirche des
Klosters Ensdorf.
 |
Bemerkenswert ist auch
die südlich des Hochaltares
liegende Sakristei
mit den
wunderbaren Schnitzereien
des frühen Rokoko
an den Schränken.
(Foto: Detail Sakristei) |
Graf
Friedrich III. von Hopfenohe-Pettendorf-Lengenfeld fand seine letzte Ruhestätte wie gewünscht in
Ensdorf, und zwar zunächst im Kapitelsaal
des Klosters. 1571 ließ Pfalzgraf Ludwig das Grab seiner Ahnen öffnen und die
Gebeine in einer Gruft im Chorraum der Kirche wieder beisetzen. Beim Neubau der
Kirche wurde nördlich des Hochaltares eine kleine Stifterkapelle errichtet, in
der nun seit 1721 die sterblichen Überreste von Graf Friedrich, seiner Frau
Heilika, ihres Sohnes Friedrich und ihres Enkels Otto ruhen.
2k.jpg)
Das Stiftergrab in der Kirche St. Jakobus
d.Ä. Ensdorf, der früheren Klosterkirche.
Im Zuge der Säkularisation
wurde das Kloster Ensdorf, wie u. a. auch Michelfeld und Speinshart,
aufgelöst. Die meisten Klostergebäude und -ländereien
gingen in Staatsbesitz über,
Privatleute erwarben kleinere Anwesen.
Die ehemalige Abteikirche, die dem hl. Jakobus
dem Älteren geweiht ist, ist seither Pfarrkirche.
Das Bistum Regensburg erwarb
große Teile der ehemaligen Klosteranlage, um darin zunächst ein Priesterhaus
einzurichten.
Seit 1920 sind die
Salesianer Don Boscos
hier.

Graf Friedrich III. hielt sich mit seiner Familie sicher
zeitweilig auch in Hopfenohe auf, wo er eine Burg bzw. ein Schloss besaß, das der Überlieferung
nach auf dem Platz des späteren Pfarrhauses (Hausnummer 1) gestanden hatte.
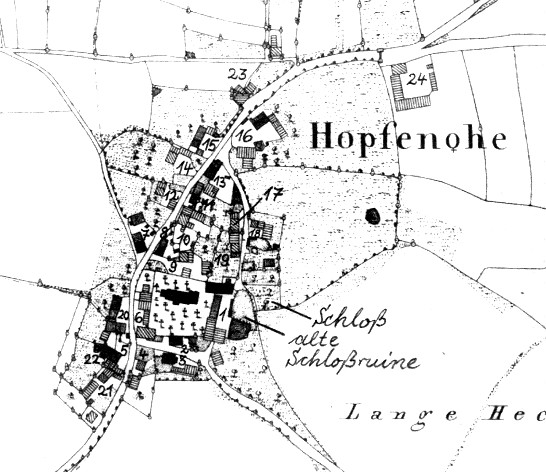
Ortsplan von Hopfenohe (4, Seite 129)
1560-85 wurde an der Ostseite des Dorfes
wieder ein Schloss errichtet. Es stand neben einer noch älteren Burg- bzw.
Schlossruine aus der Zeit der Grafen von Hopfenohe (11./12. Jahrhundert). Dieses
neue Schloss hatte aber auch keinen langen Bestand, sondern wurde in der Zeit
des dreißigjährigen Krieges zerstört und nicht wieder aufgebaut.
Gründung
des Klosters Michelfeld 1119
„Der Zeitpunkt der Klostergründung hing mit dem Tode des Grafen Friedrich von
Hopfenohe zusammen, der am 3. April 1119 das Zeitliche gesegnet hatte.“ (1,
Seite 166) Seine
zahlreichen Lehen sollten wieder ans Stift Bamberg zurückgehen, da er ohne männlichen
Erben starb. „Seine Tochter Heilika (gest. 1170) war mit Pfalzgraf Otto von Wittelsbach
(gest. 1155; begraben im Kloster Ensdorf) verheiratet. Bischof Otto fürchtete
nun, es möchte Otto von Wittelsbach die bambergischen Lehensgüter seines
Schwiegervaters für sich in Anspruch nehmen. So verglich er sich mit dem
Wittelsbacher dahin, daß er ihm einige Güter wieder verlieh, andere aber sich
zur Stiftung des Klosters vorbehielt. Dieses wurde dann auf bischöflichem Grund
und Boden erbaut.“ (1, Seite 166)
In der Stiftungsurkunde vom 6. Mai 1119 erhielt so das neugegründete
Benediktinerkloster Michelfeld auch eine
Reihe von Gütern aus der Hinterlassenschaft der Grafen von Hopfenohe, unter
anderem „Hopfenahe ex parte“, also „Hopfenohe teilweise“.
|
Den
anderen Teil
von Hopfenohe erhielt
Graf Gebhard von Leuchtenberg,
der die zweite Tochter
Friedrichs,
Heilwig, zur Frau hatte.
Die Leuchtenberg
waren ein bedeutendes
Adelsgeschlecht des Mittelalters
mit Stammsitz in Leuchtenberg
bzw. später Pfreimd.
(Wappen der Leuchtenberger) |
 |
Hopfenoher
Marktrecht nach Auerbach
Die Bedeutung Hopfenohes begann mit dem Aussterben seiner Grafen im Mannesstamme
zu schwinden. Als schließlich 1144 das Marktrecht von Michelfeld auf das Dorf
Urbach übertragen wurde, erhielt dieses auch gleich noch den Markt von
Hopfenohe. Dieser soll der Überlieferung nach größer und bedeutender als der
Michelfelder gewesen und jeweils am Donnerstag abgehalten worden sein.
1k.jpg)
Auf diesem Bild von Johann Baptist Weber von
1940 ist am Horizont in der Mitte Hopfenohe und etwas unterhalb Dornbach
dargestellt.
Die
Schlammerstor(f)fer bekommen Hopfenohe
Etwa ab 1200 sind die Ratzenberger, deren Stammschloss im Raum Erlangen stand,
die Herrn über den Teil Hopfenohes, der nicht zum Kloster Michelfeld gehörte.
1334 verkaufte z.B. Chunrad der Ratzenberger von Hopfenohe und dessen Bruder
Mathes dem Kloster verschiedene Güter in Altzirkendorf zu Gunsten ihres Vetters
Marquard Ratzenberger, der damals Mönch und 1335-1357 Abt in Michelfeld war.
1380 bis 1460 sind die Tedenreuter, auch Degenreuter genannt, in Hopfenohe; nähere
Einzelheiten über diese Zeit sind nicht bekannt.
Die nächsten drei Jahrhunderte (genau 1460-1767) gehörte Hopfenohe den Schlammerstorfern, einem alten oberpfälzischen Adelsgeschlecht mit Stammsitz im
heutigen Dorf Schlammersdorf
(Landkreis Neustadt an der Waldnaab).
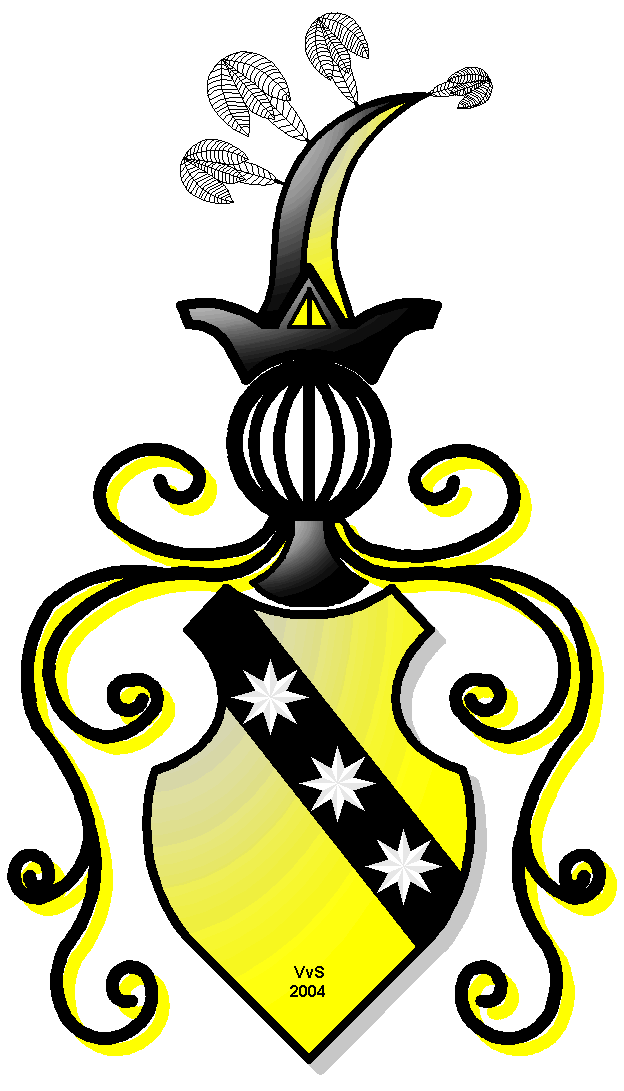 |
Familienwappen der Schlammersdorff
"Schild: In Gold ein schrägrechter,
mit drei silbernen Sternen
belegter schwarzer Balken
Helm: Gekrönt, unten goldene
gespaltene rechtshin gebogene Spitze,
oben mit einer und an der Hälfte
mit 3 Straußenfedern besteckt.
Decken: Unten golden." (Quelle) |
In diese Zeit datiert auch eine Urkunde von 1520, die besagt, dass Hans Karl der
Ältere, Bürger zu Auerbach, und sein Sohn an den Thurndorfer Burgmann Hans
Renner ein Achtel einer Erzgrube bei Hopfenohe und ein Achtel des gewonnenen
Erzes verkauften. Weiter Anteil an dieser Grube hatte u. a. der Wirt Götz von
Hopfenohe. „Diese Erzförderung war nicht so bedeutend wie die von Sulzbach
oder Amberg, aber sie spielte im Leben der Bevölkerung doch eine Rolle.“ (2, Seite 269)
Eine weitere bemerkens- und schmunzelnswerte Episode am Rande aus dem 16.
Jahrhundert ist die Bekundung des Christoph Schlammerstorfer von 1585, dass sein
Wirt Niklas Hertl in Hopfenohe von 1560 bis 1585 pro Vierteljahr 20 Eimer
Frankenwein ausgeschenkt habe.
|

|
Da
ein bayerischer Eimer 60 Maß,
also zwischen 60,4 und 68,4 Liter fasste,
betrug der Weinausschank allein in diesem
Gasthaus im Monat über 400
Liter. |
Christoph
Leonhard von Schlammerstorf errichtete 1608 in Hopfenohe eine Schmiede
(Hausnummer 13 "beim Schmie"). Der
Landrichter und die Stadt Auerbach, sowie die Gemeindeschmieden in Nunkas und
Frankenohe versuchten vergeblich, diese wieder schließen zu lassen.
Balthasar
Jakob von Schlammerstorff
Die wohl schillerndste Figur aus diesem Geschlecht war Balthasar Jakob von
Schlammerstorf zu Hopfenohe, ein Bruder des Ebengenannten. Er war u. a. 1615 bis
1621 Landrichter in Auerbach. Als enger Vertrauter des Kurfürsten Friedrich
V. (1610-1621) von der Pfalz und nachmaligen „Winterkönigs“ wurde er
von diesem mit verschiedenen diplomatischen Missionen betraut. Als Oberst eines
Regimentes nahm er auch an der Schlacht am „Weißen Berg“ kurz vor Prag am
8. November 1620 teil.
Als Maximilian I., Herzog von Bayern (1597-1651), im Jahre 1621 die
"Obere
Pfalz", d.h. einen Teil der heutigen Oberpfalz
bekam, ließ er über den Schlammerstorfer die Acht erklären. Dieser trat 1626 als dänischer Oberst in der
Schlacht bei
Lutter auf, 1627 als Straßenräuber bei Burgtann, 1629 als schwedischer Agent
in Nördlingen, dann als Oberhauptmann in Neustadt an der Aisch, wieder als Straßenräuber
zwischen Nürnberg und Neumarkt und 1632 schließlich als Generalmajor der Stadt
Nürnberg.
 |
Mit dem Schwedenkönig
Gustav
II. Adolf
zog Schlammerstorf
über Landshut und Augsburg
nach München.
|
Er rühmte
sich gern seiner Kriegsheldentaten und unterschrieb stolz: „Balthasar Jakob
von Schlammerstorf auf Hopfenohe, der Krone Schwedens und der Stadt Nürnberg
wohlbestallter Generalmajor“.
Als die Schweden Mitte März 1634 Auerbach erobert hatten und bis etwa Mitte
April besetzt hielten, konnte Balthasar Jakob nochmals in seine Heimat zurück.
1635 „verschwand Schlammerstorf spurlos und blieb verschollen bis auf den
heutigen Tag“. (3, Band XXV, Seite 18 f)
1635 scheint das Todesjahr des Balthasar Jakob von Schlammersdorff zu sein, denn
einer Quelle zu Folge datiert sein letzter Brief vom 19. Mai dieses Jahres.
Das
Ende der Schlammerstorfer auf Hopfenohe
Christoph Bernhard von Schlammerstorf, Forstmeister des Stifts Waldsassen,
erhielt nach der Ächtung seines Bruders 1621 Hopfenohe übertragen. Da er 1628
nicht katholisch werden wollte, musste er das Land verlassen. Kurfürst
Maximilian ließ Hopfenohe nun einziehen.
Nach dem „Westfälischen Frieden“ vom 24. Oktober 1648 erhielten die
Schlammerstorfer ihren angestammten Besitz zurück. Neuer Herr wurde Friedrich
Wilhelm von Schlammerstorf, Katholik und Sohn des ehemaligen Landrichters. Ihm
folgte 1675 dessen Vetter Hans Peter. Er und seine Nachkommen lebten nicht mehr
in Hopfenohe, denn das 1560-85 an der Ostseite des Dorfes neben der alten
Burgruine erbaute Schloss war in den Wirren des „Dreißigjährigen Krieges“
(1618-48) zu Grunde gegangen und nicht wieder aufgebaut worden.
Auerbachs
Stadtschreiber Schenkl erwirbt Hopfenohe
Im Jahre 1767 erwarb der Auerbacher Stadtschreiber Johann Samuel Martin Schenkl
das Landsassengut Hopfenohe und den damit verbundenen erblichen Adelstitel, um
seinen Söhnen die höhere Beamtenlaufbahn zu ermöglichen.
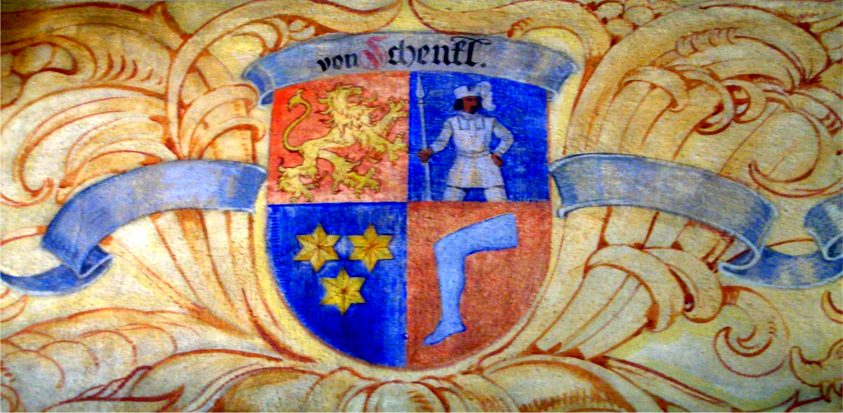
Wappen der von Schenkl (Sitzungssaal des
Rathauses Auerbach)er
Johann Samuel Martin (bis 1794) übertrug die Hofmark Hopfenohe an seinen ältesten
Sohn Franz Anton, der Regierungsdirektor der Finanzkammer in Amberg war. Dieser
hatte bereits 1786 auch das Landsassengut Portenreuth erworben. Dem
Regierungsrat Joseph von Schenkl schließlich gehörten beide Güter von 1808
bis 1825.
Destouches beschrieb die Hofmark Hopfenohe in seiner „Statistik der
Oberpfalz“ 1809 etwa folgendermaßen: Das Landsassengut Hopfenohe ist ohne
Schloß und umfaßt 14 Häuser, 156 Einwohner, 77 Tagwerk Feld und 15 3/4
Tagwerk Wiesen und Gärten. Der Viehbestand zählt 4 Pferde, 9 Ochsen, 38 Kühe
und Jungrinder, 69 Schafe, 31 Schweine. Das Pfarr- und Schulhaus sowie ein
Tagwerkerhaus gehören nicht zum Landsassenbesitz, sondern zum Landgericht.
Als Joseph von Schenkl 1825 starb, verkauften seine Erben die alten Rechte an
den Staat und den vorhandenen Grundbesitz an die Hopfenoher Bauern.
Die
Geschichte von Pfarrei und Schule in
Hopfenohe ist hier näher beschrieben.
Fahne
des katholischen Burschenvereins Hopfenohe
Auf etwas abenteuerlichem Weg kam diese rund 50 Jahren
zuvor scheinbar spurlos verschwundene Fahne des kath. Burschenvereins
Hopfenohe 1995 wieder zurück in ihre Heimat. Sie hängt heute im Treppenhaus
des Auerbacher Rathauses. (drei Fotos aus 6)
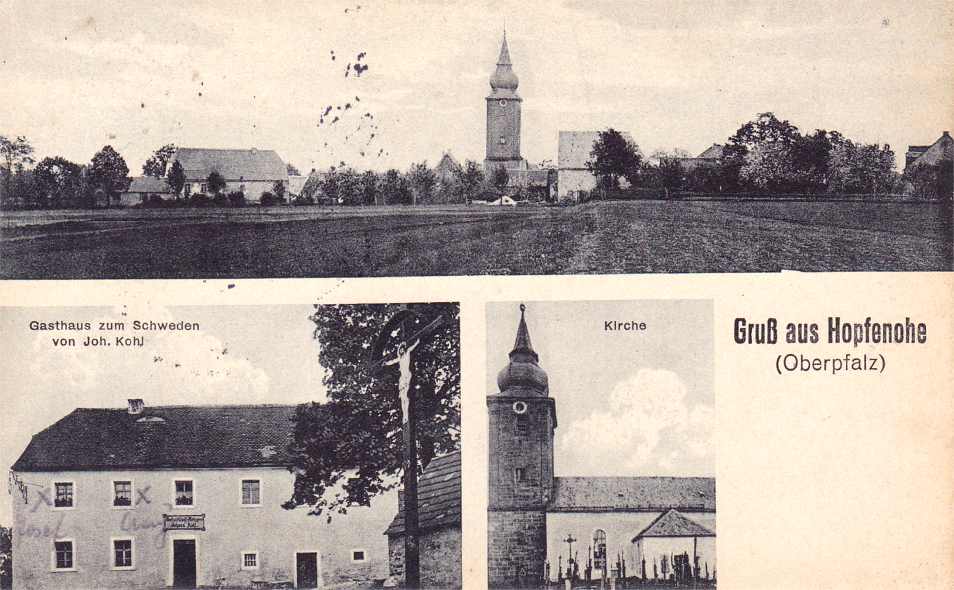
(alte Ansichtskarte aus 7)
Endgültiges
Aus 1948
Das Dorf Hopfenohe selbst blieb nach der Ablösung seiner Bewohner im Zuge der
Erweiterung des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr 1936-39 zunächst noch einige
Jahre ganz erhalten. Die Häuser dienten vor allem Zielbauarbeitern und deren
Familien als Wohnung. Nach Kriegsende nutzten auch zahlreiche Heimatvertriebene
die noch intakten Wohngebäude. Erst 1948 ließ die US-Kommandantur den Ort endgültig
räumen, und gab die Gebäude dann zum Abbruch frei. Was übrig blieb wurde mit
Ausnahme der Kirche dem Erdboden gleichgemacht.
1958 wurden in unmittelbarer Nähe der Kirche Szenen des amerikanischen Spielfilms „Zeit zu lieben, Zeit zu sterben“, u. a. mit Liselotte Pulver und
Dieter Borsche, gedreht. Dabei wirkten auch einheimische Statisten mit.
|
 |
Witterungseinflüsse
und zahlreiche „Treffer“
ließen die Ruine der Kirche von Hopfenohe
immer mehr verfallen.
Es war nur mehr eine Frage der Zeit,
wann
lediglich ein größerer Steinhaufen
an das einst stolze Gotteshaus erinnern
sollte. |
Erfreulicherweise wurden dann 2004 endlich die dringend notwendig gewordenen
Maßnahmen zur Erhaltung in Angriff genommen,
so dass die Überreste der einst stolzen Hopfenoher Kirche zumindest vor dem weiteren Verfall bewahrt
wird. Finanziert wurde dieses Projekt durch die US-Army, die Arbeiten führte
federführend ein Eschenbacher Unternehmen durch.
Am Sonntag, den 11. September 2005, fand unter reger Beteiligung der
Bevölkerung ein feierlicher Gottesdienst zum Abschluss der Arbeiten an der
nunmehr gesicherten Kirchenruine statt. Hauptzelebrant war der aus dem
benachbarten ehemaligen Ort Oberfrankenohe stammende Pfarrer Franz Schmidt.

(Foto Hans-Jürgen Kugler)
Mehr
über Hopfenohe erfährt man in dem Buch Hopfenohe –
Geschichte einer Pfarrgemeinde. (5, beim
Verfasser erhältlich)
Kugler brachte anlässlich der Feier am 11. September 2005 zusammen mit anderen
an der Außenmauer der ehemaligen Hopfenoher Kirche eine Gedenktafel in
deutscher und englischer Sprache an.
Mariengrotte
auf dem Auerbacher Friedhof
Am Samstag, dem 28. April 1990, fand auf dem Auerbacher Friedhof ein
langgehegter Wunsch vieler ehemaliger Hopfenoher seine Verwirklichung: Die
Mariengrotte wurde in einer schlichten Feier eingeweiht. In den vorausgegangenen
Wochen wurde die wohl noch aus dem 19. Jahrhundert stammende Mariengrotte des
aufgelassenen Friedhofs Hopfenohe (siehe Foto links unten)
durch die Initiative „Ehemaliger“ auf dem
Auerbacher Gottesacker originalgetreu wiedererrichtet (siehe
Foto rechts unten). Viele fleißige Hände
hatten dabei dankenswerterweise mitgeholfen. Die nach Ablösung und Krieg den Schwestern
des Mutterhauses anvertraute Marienstatue bekam damit, gleichsam in
altvertrauter Umgebung, ein neues Domizil. Im Mai 2011
wurde die gesamte Anlage überholt.
 |
 |


verwendete und weiterführende Quellen
| 1 |
Hierold,
Eugen, Die Kapelle in Schmalnohe, in Oberpfälzer Heimat, Band 14, Weiden 1970 |
| 2 |
Böhm,
Eleonore, Dorfstelle Hopfenohe, in Die Oberpfalz, Kallmünz, September 1981, |
| 3 |
Köstler, Josef, Chronik der
Stadt Auerbach, 27 handgeschriebene Bände, geschrieben etwa 1905 bis 1925 |
| 4 |
Griesbach, Eckehart, Truppenübungsplatz
Grafenwöhr, Geschichte einer Landschaft, Behringersdorf 1985 |
| 5 |
Kugler, Hans-Jürgen, Hopfenohe – Geschichte einer
Pfarrgemeinde, Auerbach 1997 |
| 6 |
Georg Hupfer, privates Archiv, Auerbach |
| 7 |
Michael Hiller, privates Archiv Grafenwöhr |
| 8 |
Böhm, Leonore,
Flurdenkmale des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr einst und jetzt, in
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz, Pressath
2011 (Seite 7-41; Gedicht Seite 23) |
| |
|
|
Die Matrikel der Pfarrei Hopfenohe und ihres
Sprengels liegen in Bamberg, auch
digital. |
letzte Bearbeitung dieses Artikels am 23. September 2025

|
Für Ergänzungen, Korrekturen usw.
bin ich sehr dankbar.
Hier können Sie mich erreichen!
|

|
 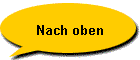 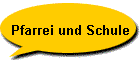
|