|
| | 
Verlorene Heimat ...
(srz)

Die
Erweiterung
des Truppenübungsplatzes
ab 1936
Mit
der Machtergreifung
durch Adolf Hitler im Januar 1933 war auch für den Truppenübungsplatz Grafenwöhr
eine neue Epoche angebrochen.
Eines der Ziele Hitlers war, eine große, modern ausgerüstete und deshalb schlagkräftige
Armee auf die Beine zu stellen, um seinen militärischen Wahnideen folgen zu
können.
 |
Die
Einführung
der allgemeinen Wehrpflicht
am 16. März 1935
diente unmittelbar dazu. |
Mit dem Gesetz zur Wiedereinführung der
allgemeinen Wehrpflicht vom 16. März 1935 wurde die frühere Reichswehr in Wehrmacht
unbenannt.
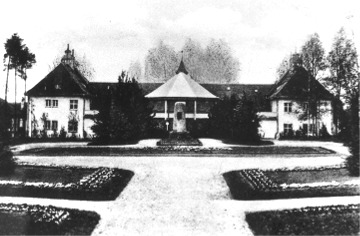
Das Offizierskasino im Lager Grafenwöhr
(zerstört 1945)
„Bereits
der 1. Weltkrieg hatte die Entwicklung neuer Waffensysteme und Munitionsarten
gebracht mit dem Ziel höherer Beweglichkeit, größerer Reichweite, schnellerer
Schußfolge und größerer Zerstörungskraft. Nach Einfrieren dieser Entwicklung
in Deutschland durch den Vertrag von Versailles wurde ab 1935 verstärkt an der
Entwicklung und Erprobung moderner, weitreichender Waffensysteme gearbeitet. War
der alte Platz bei Ausbruch des 1. Weltkrieges trotz seiner Größe von ca.
9.100 ha für die damaligen Waffen schon fast zu klein, so wurde er von der
neuen Waffenentwicklung vollständig überrollt.“ (1, Seite 10)
Das Reichskriegministerium
(bis 1935 hatte es Reichswehrministerium geheißen) ordnete mit Erlass vom 28.2.1936 die umgehende
Erweiterung des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr nach Westen hin an. Mit dem
Grunderwerb und der Aussiedlung der Bevölkerung aus den betroffenen Ortschaften
wurde die RUGES (Reichsumsiedlungsgesellschaft) beauftragt. Sie hatte eine
schwierige Aufgabe zu lösen, denn in dem vorgesehenen Gebiet lebten immerhin
rund 780 Familien mit etwas über 3.500 Menschen (1, Seite 13), die in 459 rein
landwirtschaftlichen Betrieben und 122 nebengewerblichen Höfen Arbeit und Brot
hatten.
Die RUGES "kaufte in der Ablösungsphase mehr als 2000 Betriebe auf, um sie
anschließend den Ausgesiedelten zu übergeben. ... Eine wesentliche Rolle bei der
Wahl der neuen Heimat spielte die Konfessionszugehörigkeit. Da der überwiegende
Teil der Bevölkerung des Aussiedlungsgebietes katholisch war, wurde bevorzugt in
der Oberpfalz oder anderen katholischen Gegenden Bayerns gesiedelt. Ersatzland
im nahegelegenen protestantisch-fränkischen Bereich wurde genauso gemieden, wie
der durch sein rauhes Klima bekannte Bayerische Wald." (1, Seite 13f)
„Den Verlust der eigenen Scholle und der angestammten Heimat empfanden
die Betroffenen als eine sehr große Härte. Es handelte sich vielfach um alte
Bauerngeschlechter auf Erbhöfen, die mit ihren Heimatböden, auch wenn sie
sich nur mit viel Schweiß kärglich Ertrag abringen ließen, eng verwurzelt
waren. Besonders schwer fiel es den alten Leuten, ihre Dorfgemeinschaft mit
ihrer Kirche, ihren Bekannten und Anverwandten, ihren Erinnerungen und ihren
Toten auf dem Friedhof verlassen zu müssen.“ (2, Seite 100)
Ab- und aufgelöste Ortschaften
Folgende 14 politischen Gemeinden mussten vollständig geräumt werden: Dorfgänlas,
Ebersberg, Haag, Hammergänlas, Höhenberg, Hopfenohe, Kaundorf, Langenbruck,
Leuzenof, Meilendorf, Nunkas, Oberfrankenohe, Pappenberg und Treinreuth.
Zu ihnen gehörten diese 43 Ortschaften: Altenweiher, Altneuhaus, Beilnstein,
Bergfried, Bernhof, Bernreuth, Betzlhof, Boden im Tal, Braunershof, Dörnlasmühle,
Dornbach, Eibenstock, Erlbach, Fenkenhof, Frohnhof, Grünwald, Hammermühle,
Hebersreuth, Hellziechen, Hermannshof, Kittenberg, Kotzmanns, Kühberg, Kumpf,
Luisenhof, Netzaberg, Netzart im Tal, Pinzig, Pommershof, Portenreuth, Römersbühl,
Schindlhof, Schloßfrankenohe, Schmierhütte, Sommerhau, Stegenthumbach,
Unterfrankenohe, Walpertshof, Weihern, Wirlhof, Wolfram, Zeltenreuth und
Zißenhof.
Von den 780 betroffenen Familien besaßen 579 eigene Anwesen, 201 waren Mieter
oder Pächter. (nach 1, Seite 13)

Auch Pappenberg musste weichen
Eine
sehr gute und ausführliche Darstellung der betroffenen Ortschaften und ihrer
Bewohner findet man bei Griesbach (1). Die aufgelassenen Orte Hopfenohe,
Dornbach, Haag, Beilenstein,
Portenreuth, Ebersberg,
Langenbruck, Hammergänlas,
Hellziechen und Bernreuth,
sowie einige andere (siehe Navigationsleiste unten oder oben) sind auch in dieser Website näher beschrieben.
Das
Schreiben „Zum Abschied und Geleit“ des
damaligen Langenbrucker Bürgermeisters Suttner vom 17.11.1937 gibt gut die Gemütslage
der Menschen wieder, die durch die Erweiterung des Truppenübungsplatzes ihre
angestammte Heimat verlasen mussten: „Und Ihr Bauern, die ihr so sehr mit
Grund und Boden verwachsen seid, nehmt Euch etwas Heimaterde mit und senkt sie
dort, wo Ihr hinkommt, ins neue Land, auf daß es Euch wieder zur Heimat werde.
Nehmt auch ein wenig Heidekraut mit Euch, denn wer von der Heide stammt, den läßt
die Heide niemals los, unstillbar ist sein Sehnen nach ihr. ... Und nun ein
letztes Lebewohl und der letzte Gruß mit der Mahnung: Vergesset Euere Heimat
nicht!“ (3, Ordner II, Seite 109 f)
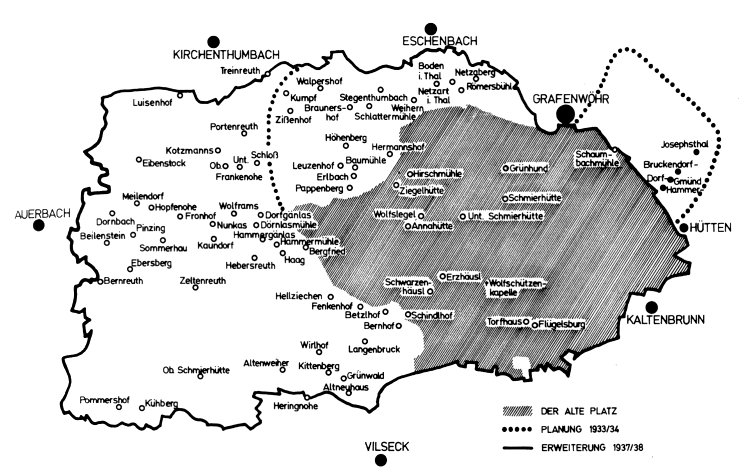
(Karte aus 1, Seite 11)

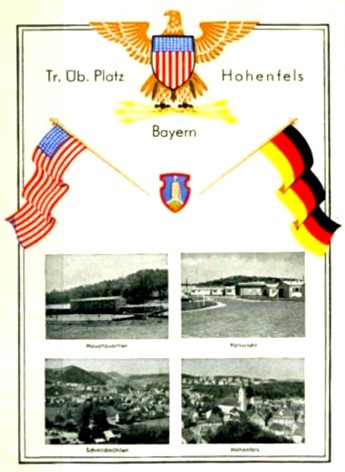 |
Der südlich der Stadt Amberg
liegende
Truppenübungsplatz
Hohenfels
wurde ab 1937
eingerichtet. Hierzu wurden
544 Anwesen und
Bauernhöfe
auf einer Gesamtfläche
von ca.11.000 Hektar abgelöst
und 1.622
Menschen umgesiedelt.
Wie in Grafenwöhr (seit 1945)
besitzt auch in Hohenfels
seit 1951 die US-Army
das Hoheitsrecht
im Truppenübungsplatz.
|

verwendete Quellen
| 1 |
Griesbach, Eckehart, Truppenübungsplatz Grafenwöhr, Behringersdorf 1985 |
| 2 |
Mädl, Helmut, Die Geschichte des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr, 1980 |
| 3 |
Chronik der Standortverwaltung Grafenwöhr, mehrere Ordner, unveröffentlicht |
|
Burckhardt, Paul, Die Truppenübungsplätze Grafenwöhr, Hohenfels, Wildflecken,
Weiden 1989 |
|
Kugler, Hans-Jürgen, Hopfenohe, Auerbach, 1997
(Bezugsquelle) |
|
Kugler, Hans-Jürgen, Nitzlbuch/Bernreuth, Auerbach, 2000
(Bezugsquelle) |
| |
Kugler, Hans-Jürgen, Pappenberg, Auerbach,
2020
(Bezugsquelle) |
|
Morgenstern,
Gerald, Truppenübungsplatz Grafenwöhr, Grafenwöhr 2010 |
|
Müller, Gerhard, 1. Oberpfälzer Kultur- und Militärmuseum
Grafenwöhr, Grafenwöhr
1990 |
|
diverse eigene Aufzeichnungen |
|
. |
 |
Hab oft
im Kreise der Lieben
Text Adalbert von Chamisso
(1781-1838)
Melodie Friedrich Silcher
(1789-1860) |

|
Für Ergänzungen, Korrekturen usw.
bin ich sehr dankbar.
Hier können Sie mich erreichen!
|

|
letzte Bearbeitung dieses Artikels am 23. September 2020
 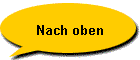 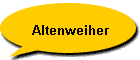 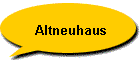 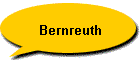  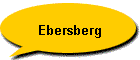     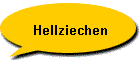 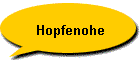    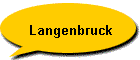 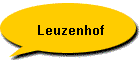 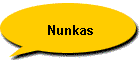 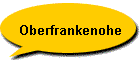 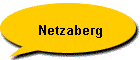 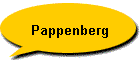 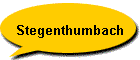 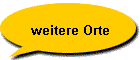
|