|
| |
Altenweiher
Ein altes Hammergut
1afkk.jpg)
Altenweiher
war ein ausgedehntes ehemaliges Hammergut. Es lag ca. 1,5 km nordwestlich
von Heringnohe zwischen der Straße von Auerbach her
und dem großen Hammerweiher mit dem Altenweiher Ursprung. Zur
besseren Orientierung sind auf dieser Karte aus der Zeit vor der Erweiterung
des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr auch umliegende Orte zu sehen. Eine Karte
und ein Luftbild
der heutigen Situation bietet der BayernAtlas an. Dort ist auch der etwas
nördlich des Gutes Heringnohe gelegene Flugplatz
zu sehen.
Gründung
der Hegner im 14. Jahrhundert
"Die Familie Hegner war das älteste bekannte Hammergeschlecht auf
Altenweiher und führte den Besitz bis etwa 1600. 1348 wurde der Hammer erstmals
namentlich in einer Urkunde erwähnt: Ulrich Hegenin zinst von 1 Hammer in
dem alten weyer nach Bamberg. 1387 besaß Hans Hegnein den Hammer zu dem
Alten Weyer. 1444 finden wir die Schreibweise Hammer zu Altenweyer
und 1625 Hammergut Alltenweyher." (1, Seite 34)
1ak.jpg) |
Das Wappen der Hegner
befand sich auch in der Kapelle
des
Hammerschlosses Altenweiher.
(Foto um 1920, aus 7)
Wie hier zu erkennen ist,
hatte jede der drei Blumen
sechs Blütenblätter, und
nicht fünf, wie weiter unten
in der Zeichnung.
|
1k.jpg)
Gut
Altenweiher bestand (Foto oben aus 3) aus dem mächtigen Hammerschloss mit
eigener Kapelle, einigen Taglöhnerhäusern, Stallungen und verschiedenen
Nebengebäuden, wie der Gutsschänke. Der Grundbesitz von zuletzt
204 ha setzte sich
überwiegend aus Weihern zusammen, die, wie selbst aus der nachfolgenden
Schwarz-Weiß-Karte
ersichtlich ist, in diesem Gebiet sehr zahlreich anzutreffen waren und noch
sind. (in Farbe: BayernAtlas)
1kkk.jpg)
Diese Weiher wurden auch nach der Ablösung
1937 noch intensiv
fischereiwirtschaftlich genutzt. Auf dieser Karte sind u.a. auch die Straße vom
ca. 11 km nordwestlich gelegenen Auerbach her, der praktisch am Nordufer des
Hammerweihers verlaufende Reutweg, und der weiter unten angesprochene Ursprung am westlichen Ende des Hammerweihers zu
erkennen.
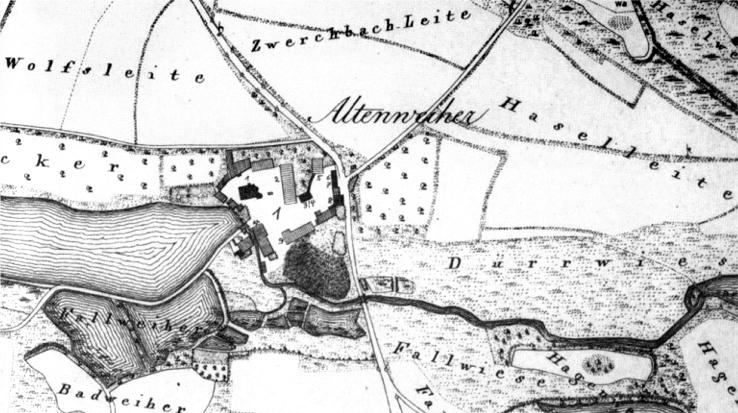
Gut Altenweiher (Plan
aus 1, Seite 163) lag an der östlichen Spitze des ca. 2 km langen Hammerweihers, der vom
am westlichen Ende liegenden Ursprung gespeist wird. Dieser Quelltopf
am Grunde des Weihers bietet ein besonderes Schauspiel.
Aus ihm sprudelt das Wasser
nach oben und führt
dabei Sand
mit sich.
 |
Der
Altenweiher Ursprung
Das Wasser drängt,
das Wasser quillt
tagsüber und bei Nacht -
nicht von Soldaten,
nicht von Kanonen -
von Büschen und Bäumen bewacht.
(Leonore Böhm, Grafenwöhr) |
"Die
Weiher, umgeben von dichtem Gestrüpp, von Schilf und Erlen, mitten im
Föhrenwald, vom Verkehr abgelegen, gaben ein Landschaftsbild von eigenem
Zauber." (6, Seite 74f) Sie "prägen auch heute noch das
Landschaftsbild." (1, Seite 33)
Die
Klausenschule
"In halber Entfernung zwischen Heringnohe und
Altenweiher stand westlich der Straße (im Bereich des heutigen Flugplatzes) die
berühmte Klausenschule. 1751 ließ sie der vermögende, aber kinderlose
Besitzer des Gutes Altenweiher, Johann Graf, an der Stelle errichten, an der
einstmals das Zollhaus gestanden hatte. Den Unterricht erteilten anfangs
Klausner (Einsiedler), so ist auch der Name Klausen als Einsiedelei zu deuten.
Nach mehr als 100jährigen Betrieb genoß sie nicht mehr den allerbesten Ruf,
nachdem die Lehrer vermutlich wegen der Einödlage zuletzt sehr der Schlaf- und
Trunksucht ergeben waren. 1876 wurde sie aufgelöst und für die Kinder der
umliegenden Höfe und Ortschaften eine neue Schule in Altneuhaus gebaut."
(1, Seite 163)
Hammerschloss
mit Kapelle
"Mächtige Linden und Eichen erhoben sich zwischen der Brücke über den
Hüttenbach und der Gutsanlage." (1, Seite 33)
.jpg) |
Aus
dem Schatten der Bäume
"trat man in den
geräumigen Hofraum
des Schlosses ...
Den Gutshof umschloß
eine drei Meter hohe Mauer."
(Text und Bild
aus 1, Seite 33f)
Links vom Torhaus war
die Gutsschänke. |
Das dominierende Gebäude von Altenweiher war das Hammerhaus, auch
Hammerschloss genannt. Es war
"ein Bau des späten 16. oder frühen 17. Jahrhunderts, vielleicht mit
Benutzung spätgotischer Bestandteile.
 |
Dreigeschossig
mit geschweiften
Giebeln. An der
Südostecke ein
dreiseitig geschlossener,
länglicher Anbau,
ebenfalls drei-
geschossig. Gegen
die Nordostecke
polygoner
Treppenturm."
(2, Seite 9)
|
Im
Erdgeschoss dieses Anbaus, an dem sich auch eine uralte Sonnenuhr befand, war
die dem hl. Johannes dem Täufer geweihte Kapelle. Sie war 1602 gebaut und vom Bamberger
Fürstbischof Johann Philipp von Gebsattel (reg. 1599-1609) geweiht worden.
1ak.jpg) |
Der Altar enthielt
zwei Bilder oder Tafeln:
Oben im Giebel war
die Anbetung der drei Weisen
dargestellt. Die Haupttafel
zeigte die Taufe Jesu
durch Johannes im Jordan.
Beide Bilder malte 1612
Johann Krapp aus Auerbach.
Dieser hatte ein Jahr zuvor
u.a. die Brüstung der Westempore
in der Auerbacher Friedhofskirche
kunstvoll bemalt. (Foto aus 2, Seite 10)
Nach der Auflösung von Altenweiher
brachte man diesen Altar
nach Dürnast
(Gem. Weiherhammer). |

Kirche Maria Immaculata, Dürnast

Am 29. Januar 1933 beschloss die
Kirchenverwaltung
Kaltenbrunn
außer dem Neubau der Ortskirche auch im dazugehörigen Dorf
Dürnast
ein kleineres Gotteshaus zu errichten.
Dürnast liegt (BayAtlas)
knapp 4 km südöstlich des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr, dessen Grenze in
diesem Bereich unmittelbar neben der B 299 verläuft.
Die Grundsteinlegung der
Filialkirche Maria Immaculata durch Pfarrer
Fenk erfolgte am 8. Oktober 1933, wie ein Gedenkstein im Innern der
Kirche neben dem Eingang rechts besagt.
1937 überließ Theresia Dorfner den frühbarocken Altar aus ihrer
Schlosskapelle Altenweiher der neuen Kapelle in Dürnast. Damit
verbunden war die Verpflichtung, an diesem Altar 50 Jahre lang alljährlich eine
Messe für die Lebenden und Verstorbenen der Familie Dorfner lesen zu lassen.
Diese Stiftungsmesse endete 1987. (Quelle)

k.jpg) |
In der
Schlosskapelle Altenweiher
war als Schlussstein
der Netzgewölbedecke
das Wappen der Familie Hegner.
Sie war, erstmals 1348 genannt,
bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts
Eigentümer von Altenweiher. |
k.jpg) |
Die drei Blumen (Rosen?)
sind auch im Wappen
des Patriziergeschlechts
Hegner
aus der Stadt Nürnberg
enthalten. Dort war 1441-1459
ein Ulman Hegner Bürgermeister.
Es scheinen also
familiäre Verbindungen
der Hegner von Altenweiher
mit denen der Stadt Nürnberg
bestanden zu haben. |
Neben dem
Hammerschloss mit der Kapelle "stand ein viereckiger turmartiger Bau mit
einem Glockentürmchen und einer kleinen Glocke, die jeden Morgen, Mittag und Abend"
den Angelus
läutete. (5, II, Seite 123)
.jpg) |
Dieser "Wohnturm" mit der Glocke
stand unmittelbar am Überlauf
des Hammerweihers.
Dieses Bächlein hieß ab hier
Hüttenbach. Auf dem Foto (1, Seite 33)
ist links der Rest der früheren Mühle und Schneidsäge,
rechts das Hammerschloss zu sehen.
Der Eisenhammer stand ebenfalls rechts.
(historische Karte aus dem BayernAtlas) |
Die
letzen Eigentümer und das Ende
Um
das Jahr 1740 erwarben Georg Graf und sein Schwiegersohn Heinrich Heeg
gemeinsam Altenweiher von dessen Vorbesitzer, dem Freiherrn zu Lichtenstern.
(nach 7) Georg Graf war ein Bauer aus Oberweißenbach (heute Ortsteil
der Stadt Vilseck). Er ist der Vorfahr des Geschlechts derer von
Grafenstein auf Hammergänlas.
Ihm gehörte schon seit 1722 das damals erworbene Hammergut Altneuhaus. Wenige Jahre
später erwarb Graf auch den Hammer Heringnohe.
1746-1897 war das Hammergut Altenweiher im Eigentum der Familie Heeg, die am 2.
Mai 1782 in den Kurbayerischen Adelsstand erhoben wurde. 1866 wurde der
Hammerbetrieb unter Max von Heeg eingestellt und das Gut 1897 an die Dorfner
verkauft.

Bei der Ablösung 1937 (Foto aus 3) gehörte Altenweiher
zur politischen Gemeinde Langenbruck und zur
Pfarrei Vilseck, Filiale Langenbruck. Die Kinder gingen in Altneuhaus zur
Schule.
Letzter Eigentümer des großen Gutes war seit 1897 die Familie Dorfner.
Nach der Ablösung und Räumung wurde Gut Altenweiher zunächst bis Kriegsende durch die Heeresstandortverwaltung Grafenwöhr
weiterbewirtschaftet. Letzter Bewohner nach dem Krieg, also schon "in der
amerikanischen Ära", war bis Herbst 1956 Georg Luft mit seiner Familie.
Danach zogen die Lufts nach Sorghof.
Im Spätherbst 1957 wurden an verschiedenen Schauplätzen im Truppenübungsplatz
Grafenwöhr Szenen für den amerikanischen Spielfilm "A
Time to Love and a Time to Die" (deutsche Version: Zeit zu lieben
und Zeit zu sterben) nach Erich Maria Remarques Roman
Zeit zu leben und Zeit zu sterben
(1954)
gedreht. Drehorte waren u.a. das Hammerschloss Altenweiher, das alte Dorf Bernreuth
und die Kirchenruine von Hopfenohe.
Danach verfielen die einst stattlichen Gebäude von
Altenweiher allmählich, wie die folgenden
beiden Fotos (aus 4) zeigen. Zunächst die alte Gutsschänke, die links vom
Eingangstor zum Gut stand.
k.jpg)
Das einst so stolze Hammerschloss war zum
Schluss in einem erbärmlichen Zustand. Die Kapelle war schon eingefallen;
zumindest ein Teil der Einrichtung kam nach Dürnast,
heute ein Ortsteil von Weiherhammer.
k.jpg)
Erst 1967 wurden die noch verbliebenen Gebäuderuinen von Altenweiher durch die Amerikaner restlos niedergerissen.
Der Eintrag Dorfstelle Altenweiher erinnert noch an das uralte Hammergut
aus dem 14. Jahrhundert.

verwendete und weiterführende Quellen
| 1 |
Griesbach, Eckehart, Truppenübungsplatz Grafenwöhr, Behringersdorf 1985 |
| 2 |
Hager, Georg, Die Kunstdenkmäler des
Königreichs Bayern, Regierungsbezirk Oberpfalz und Regensburg, XV
Bezirksamt Amberg, München 1908 |
| 3 |
Archiv Armin Knauer, Grafenwöhr |
| 4 |
Archiv Willi Zinnbauer, Sorghof |
| 5 |
Chronik der Standortverwaltung Grafenwöhr, mehrere Ordner, unveröffentlicht |
| 6 |
Chronik der Ortschaft Sorghof, Sorghof 1988 |
| 7 |
Archiv Christian König |
| 8 |
Böhm, Leonore,
Flurdenkmale des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr einst und jetzt, in
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz, Pressath
2011 (Seite 7-41; Gedicht Seite 15) |
letzte Bearbeitung dieses Artikels am 18. Mai 2022

|
Für Ergänzungen, Korrekturen usw.
bin ich sehr dankbar.
Hier können Sie mich erreichen!
|

|
 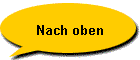
|