|
| |
 |
Diese Glocke - heute in der Friedhofskirche
St. Leonhard in Michelfeld am rechten
Seitenaltar - war von 1946-85 auf dem Anwesen Winter/Krieger in
Fischstein. Den Menschen dort läutete sie u. a. täglich zum Engel des
Herrn, auch Angelus
genannt. Sie verkündete den Dorfbewohnern als Totenglocke auch, wenn jemand aus ihren Reihen gestorben war.
Die Toten von Fischstein sind auf dem Friedhof in Michelfeld beerdigt,
weil das Dorf von jeher gemeindlich, pfarrlich und schulisch zu Michelfeld
gehörte. |
Fischstein
einst
Dorf und Eisenhammer an der Pegnitz
An
Christi Himmelfahrt des Jahres 2001 erhielt um 17.00 Uhr im Rahmen der schon
traditionellen Maiandacht an der Kapelle in Fischstein der dort neu aufgestellte
Gedenkstein den kirchlichen Segen. Im Anschluss daran wurde bei einem gemütlichen
Beisammensein im Gasthaus Leißner in Mosenberg die von mir
zusammengestellte und verfasste Chronik mit dem Titel Werden und Vergehen
des Eisenhammers und des Dorfes an der Pegnitz vorgestellt.
kk.jpg)
Exemplare
der mittlerweile 3. (unveränderten) Auflage von 2018 können über die ehemaligen
Fischsteiner Wirtsleute Anni und Martin Lehner (Pegnitz)
bezogen werden.

Rund zehn Jahre waren vergangen, seit das
letzte Haus der ehemaligen Ortschaft Fischstein an der Pegnitz geräumt und
abgebrochen wurde. Im Bewusstsein, dass die Erinnerung an diese jahrhundertealte
menschliche Siedlung allmählich verblasst, wurde auf Initiative der ehemaligen
Fischsteiner Wirtsleute Anni und Martin Lehner, heute in Pegnitz wohnhaft, bei der
Kapelle ein imposanter Findling aufgestellt. Seine Inschrift lautet: Fischstein – aufgelöst 1960 bis 1991
- Dorf und Eisenhammer – erstmals genannt anno 1326.
Zugleich wurde an der Kapelle eine Tafel angebracht, die in wenigen Worten an
Fischstein erinnert: Hier standen jahrhundertlang Dorf und Eisenhammer
Fischstein. Die einstmals blühende Ortschaft befand sich innerhalb der 1960
ausgewiesenen engeren Schutzzone des Trinkwasserschutzgebietes der damaligen EWAG
Nürnberg (heute N-ERGIE; die
Stadt Nürnberg bezieht seit 1912 einen Teil ihres Trinkwassers
aus dem Gebiet Ranna).
Aus diesem Grunde wurden die einzelnen Anwesen in den Jahren 1960 bis 1991
umgesiedelt bzw. abgelöst, die Gebäude abgebrochen. Nähere Einzelheiten
erfahren Sie auch in einer von mir verfassten kleinen Ortschronik, die im
nun leider geschlossenen Gasthof Leißner (Mosenberg)
erhältlich war. (NN)
Aus dieser kleinen Ortschronik, die mit zahlreichen Bildern und Fotos
aus der reichen Vergangenheit von Fischstein ergänzt ist, hier einige Auszüge.
Hammer
aus dem 14. Jahrhundert
Der Eisenhammer Fischstein ist wohl eine Gründung der Familie Pogner, die im
14. Jahrhundert in Auerbach eine große Bedeutung hatte und
wahrscheinlich um
diese Zeit aus Nürnberg zugewandert war. Der volkstümliche Namen
Bognersiedlung und die offizielle Straßenbezeichnung Bognerstraße erinnern in
Auerbach an dieses Geschlecht. Im Salbuch von 1326 wird „apud
Awerpach malleum Pognarii“ genannt, also ein Hammer des Pogner bei
Auerbach. An anderer Stelle im gleichen Verzeichnis ist die Rede von „de
malleo Pognerinne“, vom Hammer der Pognerin. Hiermit ist nach Meinung von
Experten der Hammer Fischstein gemeint, denn noch 1406 heißt es in einer
Urkunde „hamer und hamerstatt
Fischstein, etwenn (d.h. vormals) der
Pognerin hamer genant“, also
Hammer und Hammerstätte Fischstein, vormals Hammer der Pognerin genannt.
In der bedeutenden Oberpfälzer Hammereinung vom 7. Januar 1387 ist mit Nummer
51 von insgesamt 66 Unterzeichnern der Hammerwerksbesitzer „Hainr Ater mit dem
hamer Entenstain“ zu finden. Nach Rees (Geschichte
und wirtschaftliche Bedeutung der Oberpfälzischen Eisenindustrie von den
Anfängen bis zur Zeit de 30jährigen Krieges, in VHVOR 1950, S. 91) ist damit der Hammer Fischstein gemeint, der kurzzeitig, wahrscheinlich
zur Unterscheidung von der inzwischen um ihn herum entstandenen Ortschaft
Fischstein, den Namen Entenstein trug.
Beschreibung
eines Hammerwerks
Noch 1827 war in Fischstein neben der Hammerschmiede auch ein so genannter Zerrennherd, der schon 1387 bei der Großen Hammereinung betrieben wurde. Georg
Agricola, der große Montanwissenschaftler aus Sachsen, beschrieb 1556 einen
solchen Schmelzofen und seine Funktionsweise in Band 9 seiner 12 Bücher
„Vom Berg- und Hüttenwesen“ sehr genau. Danach war dieser Zerrennherd, auch
Rennfeuer genannt, ein einfacher, gemauerter Herd, „3
½ Fuß hoch und je 5 Fuß lang und breit“, also ca. eineinhalb Meter lang
und breit und einen Meter hoch. In der Mitte war eine schüsselartige
Vertiefung, Tiegel genannt, von etwa 50 Zentimeter Durchmesser und 35 Zentimeter
Tiefe. „Wenn der Meister, auch Renner
genannt, ... seine Arbeit beginnt, wirft er zunächst Holzkohlen in den Tiegel
und streut dann über diese eine eiserne Schaufel voll zerkleinertes Erz,
gemischt mit Kalk, der noch nicht im Wasser abgelöscht worden ist. Dann gibt er
wiederum Kohlen auf und streut Erz darüber und wiederholt das so lange, bis er
einen schwach ansteigenden Haufen gebildet hat. Diesen schmilzt er, indem er die
Kohlen anzündet, den Wind aus den Blasbälgen ... anläßt und so das Feuer kräftig
anfacht. Die Arbeit kann in 8 Stunden beendet sein, manchmal auch erst in 10
oder 12 Stunden.“ Wenn das Erz geschmolzen ist, „öffnet der Meister mit einem Stecheisen den Stich für die Schlacke;
nachdem sie vollständig abgeflossen ist, läßt er den Eisenklumpen (die
Massel) im Tiegel erstarren. Er selbst und seine Gehilfen heben ihn sodann
mit eisernen Brechstangen aus dem Ofen heraus, werfen ihn auf die Hüttensohle,
bearbeiten ihn mit Holzhämmern, deren Stiele dünn, aber 5 Fuß lang
sind, schlagen die noch an ihm hängenden Schlacken ab und verdichten und
schlagen ihn so zugleich etwas breit. Denn wenn man ihn sofort auf den
Amboß legen und mit dem großen eisernen Hammer ausschmieden wollte, der
von den Daumen einer Wasserradwelle angetrieben wird, würde er
zerspringen.Bald darauf aber wird er mit Zangen gefaßt und unter dem
Hammer mit einem zugeschärften eisernen Meißel in 4 oder 5 oder 6 Stücke,
je nachdem er klein oder groß war, zerteilt. Aus diesen Stücken stellen,
nachdem sie in einem anderen Herd (dem Schmiedefeuer) von neuem erhitzt
und wieder auf den Amboß gelegt worden sind, die Schmiede rechteckige Stücke,
Pflugscharen, Radreifen oder meist Stangen her, von denen 4 oder 6 oder 8
etwa 1/5 Zentner wiegen. Aus ihnen wiederum pflegen sie sehr verschiedene
Gegenstände zu fertigen.
|
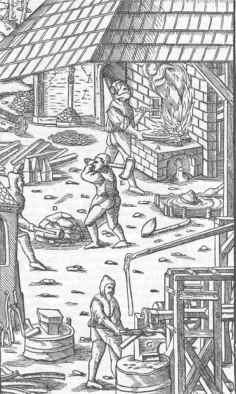
|
Bei jedem Schlage des Hammers gießt ein Junge
aus einem Löffel Wasser auf das glühende Eisen, das vom Schmied
bearbeitet wird, und daher kommt es, daß die Hammerschläge so laut dröhnen,
daß man es in weiter Entfernung von der Schmiede noch hört. Nachdem man
den Eisenklumpen aus dem Ofen, in dem das Erz geschmolzen wurde,
herausgenommen hat, pflegt im Herd ein hartes Eisen zurückzubleiben,
welches sich schwer ziehen läßt. Aus ihm kann man besonders die eisernen
Schuhe der Pochstempel und sonstige Gegenstände, die sehr hart sein müssen,
herstellen.“
|
So ähnlich könnte auch das Hammerwerk Fischstein
ausgesehen haben mit dem Zerrennherd zum Schmelzen des Eisenerzes und den
verschiedenen Vorrichtungen zum Schmieden des Roheisens. (Bild und obiger Text
aus Georg Agricola, Vom Berg- und Hüttenwesen, dtb-Verlag, München 1994,
Seiten 364 ff)
Stromer und
die Stadt Auerbach Hammerherren
Auch die Stromer, aus deren
Auerbacher Geschlecht der bedeutende Dr. Heinrich Stromer stammt,
welcher
insbesondere als Begründer des weltbekannten Weinlokals Auerbachs Keller in
Leipzig in die Geschichte einging, waren im 15. Jahrhundert mehrere Jahrzehnte
Betreiber des Hammers Fischstein. Andere Hammerherren aus dieser Zeit waren u.
a.
die Lohneysen und die Zeller, die damals im Sulzbacher Raum eine bedeutende
Rolle in der Eisenindustrie spielten.
 |
Diese alte Zeichnung von 1522/23 zeigt von oben
nach unten dem Lauf der Pegnitz nach die drei an dieser gelegenen Hämmer
Fischstein, Rauhenstein und Ranna. Am oberen Kartenrand ist der Hammer
Fischstein mit einem mächtigen Wasserrad und zwei Nebengebäuden zu
erkennen. Es handelt sich hier wohl um die erste noch erhaltene bildliche
Darstellung der Ansiedlung Fischstein.
|
Das
Eisenerz für die
einheimischen Hämmer an der Pegnitz lieferten entweder Auerbacher Privatleute
oder aber vor allem „Erzgraber“ aus dem Sulzbacher Raum. Die dortigen
Erzlager lagen nicht so tief wie die hiesigen und die Erze von dort waren zudem
von geringerer Härte als die aus dem Raum Auerbach. Die Hämmer Ranna und
Fischstein bezogen zu Beginn des 30-jährigen Krieges fast ihr gesamtes Eisenerz
aus Siebeneichen, ca. 3 km südöstlich von Sulzbach-Rosenberg nahe der B 85
gelegen. Dort betrieb zu dieser Zeit Pfalzgraf August von Sulzbach ein blühendes
Bergwerk. Auch aus der Gegend um Betzenstein wurde Eisenerz herangeschafft und
wie oben beschrieben geschmolzen.
Die verschiedenen
Hammererzeugnisse aus Fischstein wurden wie die anderer Hämmer unserer Gegend jahrhundertlang
nach Nürnberg geliefert, aber auch an einheimische Kunden veräußert.
1618, also zu Beginn des 30jährigen
Krieges, kaufte die Stadt Auerbach von Hans Wilhelm Zeller den Hammer Fischstein
mit allem Zubehör um 7.200 fl und 100 Reichstaler Leihkauf. Dazu gehörten u.
a.
auch das Fischwasser der Pegnitz, die umfangreichen Fischerei- und Forstrechte
und verschiedene Michelfelder Grundstücke, denn der Hammer Fischstein gehörte
von Anfang an grundrechtlich, kirchlich und schulisch zum 1119 gegründeten
Benediktinerkloster Michelfeld.
Im Laufe des schrecklichen 30jährigen
Krieges (1618-1648) wurden auch Hammer und Dorf Fischstein arg in
Mitleidenschaft gezogen; die Stadt baute ihr Hammerwerk gegen Ende des 17.
Jahrhunderts praktisch wieder neu auf und betrieb es dann schwunghaft weiter.
Ende des Hammers Fischstein
Fischstein gehörte insgesamt
knapp 250 Jahre zur Stadt Auerbach und diese unterhielt nach wie vor den
Eisenhammer, den sie allerdings nicht immer selber betrieb, sondern verpachtete,
meistens an dem Magistrat genehme Personen oder gar an Räte direkt. Diese
Praxis führte zu Missständen, wie Joseph Köstler (1849-1925), der große
Chronist von Auerbach überliefert. „Der
Reinertrag der Hammergüter für die Stadtkammer war sehr gering, weil fast die
ganze Pachtsumme wieder für Baureparaturen, Steuern usw. verwendet werden mußte.
Der Holzverbrauch war kolossal, die Eisenproduktion aber minimal und an Qualität
minderwertig. Für die Pächter aber waren die Hammergüter immer noch ergiebige
Melkkühe. Wenn auch der Eisenhandel nicht mehr viel Gewinn abwarf, so war doch
mit dem Holz und Feldbau manches Profitchen zu machen und die Ergebnisse der
Forellenfischerei und der Karpfenweiher waren auch nicht zu verachten. Die
Regierung war mit der Mißwirtschaft des Magistrats schon längst unzufrieden
und wollte besonders die Beteiligung von Magistratspersonen am Pacht nicht mehr
gestatten. Mit Grollen und Mißtrauen kontrollierte der Landrichter den Geschäftsbetrieb,
zahlreiche Denunziationen lieferten das Material zu seinen Beanstandungen.
... Am meisten indigniert über die Hämmer war aber die Forstverwaltung,
„denn die Hämmer, diese nichtsnutzigen Holzverschwender, fressen noch den
ganzen Wald zusammen“.“
(Köstler, Band XIX, Seite 365)
Der Hammer Fischstein bekam nämlich
jährlich aus dem Veldensteiner Forst gratis 86 1/3 große Nürnberger
Klafter Kohlholz (ein Klafter waren etwa 3 m³) und für das Meixnergütl noch
extra 5 Klafter Brennholz nebst Streurecht und dem nötigen Bauholz.
Die Stadt trat deshalb Anfang des Jahres 1859 mit dem
Staat in Verkaufsverhandlungen über die Hämmer in Ranna und in Fischstein.
Die Schätzung für Fischstein kam auf 37.261 Gulden, für Ranna und Fischstein
zusammen auf über 95.000 Gulden. Zum Hammer Fischstein gehörten zu dieser Zeit
immerhin 171 Tagwerk 19 Dezimal Felder, Wiesen, Weiher, Wald und Ödungen. Dem
Fiskus war dieser Betrag zu hoch und nach einer weiteren Schätzung und zähen
Verhandlungen kam es am 5. Oktober 1859 zu folgendem Ergebnis: Die Stadt
Auerbach verkaufte das Hammergut Fischstein gemeinsam mit dem von Ranna und den
dazugehörigen Ländereien im Gesamtumfang von 467,41 Tagwerk und den großen
Forst- und Fischereirechten an den Bayerischen Staat um 72.000 Gulden. Der
Hammerbetrieb war damit erloschen.
Eine nette Episode am Rande
dieses Geschäftes überliefert Köstler: „Am 1. April 1860 trat der Staat
in den Besitz der erworbenen Güter. Am 21 Juni 1860 wurde in Regensburg dem (Auerbacher)
Bürgermeister Leonhard Neumüller der Gesamtkaufschilling in lauter Silber
ausbezahlt. Er verpackte das Geld in eine starke Holzkiste und transportierte
es, wie er mir öfter erzählte, auf einem gewöhnlichen Leiterwagen und unter
größter Angst vor räuberischen Überfällen nach Auerbach.“ (Köstler,
a.o.O. 367f)
Gemeindliche Zugehörigkeit
Um das Hammerwerk herum siedelten
sich im Laufe der Jahrhunderte zu den dort beschäftigten Arbeitern und ihren
Familien auch Landwirte und andere Leute an, zwei Wirtshäuser förderten das
geselligen und gesellschaftlichen Leben der Dorfbewohner. Ab einer bestimmten Größe
war Fischstein bis ins vorletzte Jahrhundert eine mehr oder weniger selbstständige
Ortsgemeinde mit einem eigenen Ortsvorsteher an der Spitze.
Durch die staatliche
Neugliederung Bayerns zu Beginn des 19. Jahrhunderts (durch die Gemeindegesetze von 1808
und Gemeindeverfassung von 1818) gehörte das Dorf Fischstein bis herauf in
unsere Tage zur politischen Gemeinde Höfen (gut 4 km südwestlich von
Fischstein), und mit dieser etwa 150 Jahre zum Landkreis Pegnitz im
Regierungsbezirk Oberfranken.
Im Zuge der
Landkreisgebietsreform von 1972 wurde Höfen nach Mittelfranken umgegliedert,
zunächst als weiterhin selbstständige Gemeinde in den Landkreis Nürnberg,
der bald in Nürnberger Land umbenannt wurde. Aus den Oberfranken, die zu Kirche
und Schule in die Oberpfalz gehörten, wurden nun durch Verordnung
Mittelfranken.
Mit Wirkung vom 1. Mai 1978 wurde
die politische Gemeinde Höfen aufgelöst und in die Marktgemeinde
Neuhaus/Pegnitz eingegliedert (Gemeindegebietsreform). Letzter Bürgermeister
von Höfen und damit auch von Fischstein war Johann
Leißner (+2008) aus Mosenberg, der
anschließend noch bis 1996 als 1. Bürgermeister die Geschicke des größer
gewordenen Marktes Neuhaus bestimmte.
Trinkwasser für Nürnberg
Die Stadt Nürnberg bezieht seit
dem 8. Juni 1912 einen Teil ihres Trinkwassers aus dem Raum Ranna, derzeit sind
es rund 45.000 m³ pro Tag. Das kostbare Nass fließt seither tagtäglich mit
einer Geschwindigkeit von stellenweise rund einem Meter pro Sekunde in einer ca.
45 km langen Rohrleitung von etwa 1 m Durchmesser im freien Gefälle zum Hochbehälter
Schmausenbuck in die fränkische Großstadt.
Als ersten Schritt dazu hatte Nürnberg
1902 das Anwesen des Landwirts Haselbeck der Einöde Haselhof und andere Flächen
von Brand erworben, insgesamt ca. 8,5 ha. Die dort entspringenden ca. 40 Quellen
wurden in den folgenden Jahren gefasst und werden heute als Ranna I bezeichnet.
Zwischen den beiden Weltkriegen wurden u. a. die Seizer- und Kohlmesserquelle
als Ranna II gefasst, um den weiter gestiegenen Trinkwasserbedarf der Stadt
Nürnberg mit zu befriedigen.
Bereits im Jahre 1907 wurde durch
das Oberbergamt München für die Quellen bei Ranna ein Schutzbezirk
ausgewiesen, der 1911 erweitert wurde. Das gemeinsame Wasserschutzgebiet für
Ranna I (Haselhoffassung) und Ranna II (Seizer- und Kohlmesserquelle) wurde
1960 festgelegt und hat eine Größe von 86 Hektar im Fassungsbereich, 1.600 ha
in der engeren und 6.120 ha in der weiteren Schutzzone; ca. 40 % davon liegen in
der Gemarkung Auerbach; die Stadt Auerbach bezieht seit dem 7. Mai 1981 ihr
Trinkwasser ebenfalls von dort.
Ablösung der Anwesen durch die
(frühere)
EWAG
Da Fischstein wie die anderen
alten Ortschaften Rauhenstein, Ober- und Unterbrand und Mosenberg in der engeren
Wasserschutzzone liegt bzw. lag, wurden die Anwesen im Laufe der Jahrzehnte
von der damaligen EWAG (heute N-ERGIE) aufgekauft und abgerissen. In der engeren Schutzzone wurden die
Bestimmungen durchgesetzt, Bauwillige erhielten z.B. keine Genehmigungen mehr für
größere Umbaumaßnahmen oder gar zur Neuerrichtung von Häusern.
Einige Häuser, die schon zur Blütezeit des
Hammerwerkes bestanden, blieben noch ein paar Jahre länger als alle anderen. Es
war dies z.B. bis 1977 das ehemalige Hammerschmiedhaus Nr. 3 (Krieger, beim
Winter) mit der Glocke auf dem Dach; das alte Glöcklein war während des
zweiten Weltkrieges wie viele andere Glocken eingeschmolzen worden, die 1946
angeschaffte befindet sich heute in der St. Leonhardskirche in Michelfeld beim
Kreuzaltar und erinnert an die jahrhundertelange Zugehörigkeit Fischsteins
zur Pfarrei Michelfeld.

Ebenfalls
1977 abgebrochen wurde der bis dahin von den Wirtsleuten Lehner betriebene
Gasthof Bergmannsquelle (Hausnummer 13). Anni und Martin
Lehner waren auch die Herausgeber der eingangs angesprochenen
heimatkundlichen Broschüre Fischstein - Werden uns Vergehen des Eisenhammers
und des Dorfes an der Pegnitz.

Als
letztes Anwesen Fischsteins hielt das Haus Nr. 6
(Ziegler, beim Mühlbauer) bis
1991 die Stellung.
Die Kapelle von Fischstein
Früher war die kleine Kapelle
ein Mittelpunkt der ganzen Ortschaft, heutzutage steht sie völlig allein da.
Sie wurde vor einigen Jahren renoviert und wird von früheren Einwohnern
des Ortes liebevoll gepflegt und von diesen und auch von vielen Spaziergängern
gern besucht. Wann genau dieses Zeichen der Volksfrömmigkeit entstanden
ist lässt sich nicht exakt sagen; auch der Realschematismus des Erzbistums
Bamberg macht darüber keine Angaben. Jedenfalls wird das schmucke Kapellchen
schon einige Jahrhunderte an dieser Stelle stehen.

Den Altar ziert ein vom örtlichen Kunstmaler Schachtel
auf Holz gemaltes Muttergottesbild mit der Aufschrift „Margaretha Winter
1867“ und dem Zusatz „O Maria steh uns bei“.
Rechts und links des Altarbildes erinnern zwei Tafeln an die Gefallenen
des Ortes: „1914 - 1918 Den tapferen Kämpfern zum ehrenden Gedächtnis:
Neubig Hans, Hollfelder Georg, Ziegler Michael, Mitterer Johann“ steht
auf der einen und auf der anderen Tafel sind die Gefallenen des letzten
Krieges 1939/45 vermerkt: „Albert Zeilmann, Peter Zeilmann, Georg
Zeilmann, Georg Hollfelder, Martin Mitterer, Hans Ziegler, Georg Kohl“
Im Frühjahr 2005 wurde vor allem das Innere der Fischsteiner Kapelle gründlich
renoviert; so wurde u.a. das Altarbild aufgefrischt und zu seinem Schutz ein von
der N-ERGIE (früher EWAG)
finanziertes schmiedeeisernes Gitter angebracht. Zum Abschluss der Renovierungsarbeiten
hielt am Sonntag, den 7. August 2005, im Beisein zahlreicher - insbesondere
ehemaliger Fischsteiner - Gläubiger Pfarrer i.R. Heinrich Schenk eine
feierliche Marienandacht.
Uns im 21. Jahrhundert und wohl auch künftige
Generationen erinnern die Kapelle und der am 24. Mai 2001 errichtete
Gedenkstein neben wenigen kümmerlichen Mauerresten und einigen verwildernden
Obstbäumen daran, dass hier einst Hammer und Dorf Fischstein gestanden haben
und Menschen mit Fleiß und ihrer Hände Arbeit ein Auskommen hatten.
Geblieben aber ist ein schönes Fleckchen Erde, das manchem Wanderer Erholung
und Freude bereitet.

Mindestens einmal im Jahr, meistens an Christi
Himmelfahrt, treffen sich ehemalige Fischsteiner und zahlreiche Gläubige der
Umgebung an der Kapelle zu einer Maiandacht, die in der Regel vom Neuhauser Pfarrer
gehalten wird. (2010 NN,
2018
SRZ)
letzte Bearbeitung dieses Artikels am 17. Mai
2018

|
Für Ergänzungen, Korrekturen usw.
bin ich sehr dankbar.
Hier können Sie mich erreichen!
|

|

 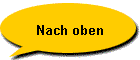
|