|
| |
Die
alten Messbenefizien
der Pfarrei Auerbach
Der Pfarrer von Auerbach war schon
bei der Pfarreierhebung 1144 verpflichtet
worden, einen Kaplan und einen
Schulmeister anzustellen. Bald kamen dazu noch Mess-Stiftungen oder Benefizien, die
jeweils mit einem Priester mit eigenem Einkommen, auch
Pfründe genannt, besetzt waren.
Johannes Neubig, dessen Schrift "Auerbach, die ehemalige Kreis- und
Landgerichts-Stadt in der Oberpfalz" (1) im Jahre 1839 gedruckt und
herausgegeben wurde, hat ausführlich
über diese Einrichtungen geschrieben. Hier wird seine Abhandlung in
leicht gekürzter Form wiedergegeben, teilweise ergänzt aus anderen
Unterlagen.
Neben einem beständigen Pfarrer (plebanus oder verus et perpetuus
rector) besaß die Pfarrei St. Johannes der Täufer in Auerbach zur Besorgung
ihrer ewigen und göttlichen Seelenangelegenheiten und zur höheren Bildung und Übung eines frommen und
guten Lebenssinnes auch noch sieben
Benefiziaten - ein neuer Beweis
des alten sowohl bürgerlichen als auch religiösen Wohlstandes; denn jeder
Benefiziat hatte sein ganz hübsches Einkommen und dazu sein eigenes Wohnhaus.
Die Auerbacher Pfarrkirche hatte schon immer
außer dem Haupt- oder Hochaltar mehrere Seitenaltäre. Auf ihnen zelebrierten
die Benefiziaten regelmäßig ihre hl. Messen. Auch Gastpriester wichen auf
diese Nebenaltäre aus, denn die heutige Form der
Konzelebration mehrerer
Priester gibt es eigentlich erst seit dem 2. Vatikanischen Konzil
(1962-65).
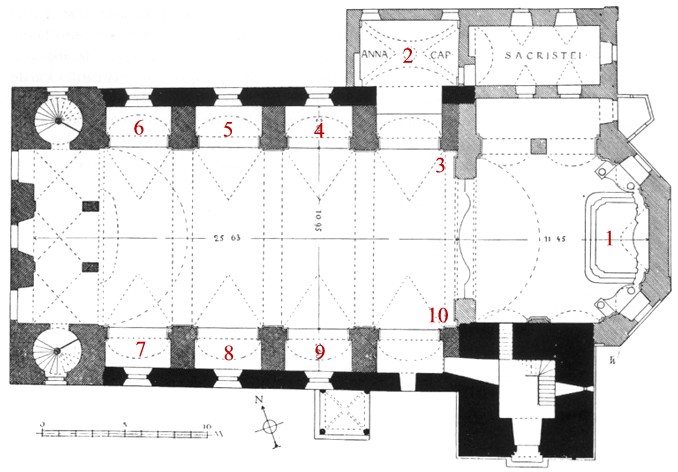
Auf diesem Grundriss der Pfarrkirche St.
Johannes der Täufer sind die Altäre eingetragen, wie sie seit dem 17.
Jahrhundert bestehen. Auch vorher gab es in diesem Gotteshaus natürlich schon
mehrere Altäre, an denen regelmäßig hl. Messen gefeiert wurden.
| 1 |
Hochaltar; das Altarbild zeigt die Taufe Jesu
im Jordan durch Johannes |
| 2 |
Annakapelle; Barockaltar mit Darstellung der
Maria als Kind mit ihrer Mutter Anna |
| 3 |
Frauenaltar; Maria als Braut des hl. Geistes,
oben im Auszug der hl. Josef; neben dem Frauenaltar steht auch der
gotische Taufstein von 1525 |
| 4 |
Hl. Familie; Ölgemälde der hl. Familie mit
Gottvater und hl. Geist |
| 5 |
Marienaltar; Akanthus mit vier Engelputti;
spätgotische Marienstatue (um 1500) |
| 6 |
Barbaraaltar; Aufbau ähnlich wie der
Marienaltar, aber schwererer Akanthus; Barbarastatue (um 1500) |
| 7 |
Jakobusaltar; Akanthus; der hl. Jakobus war
der erste Kirchenpatron; Barockstatue des hl. als Pilger |
| 8 |
Sebastianaltar; Akanthus; Barockfigur des
hl. Sebastian am Marterpfahl |
| 9 |
Kreuzaltar; Altarblatt mit Kreuzigung
Christi; barock; oben im Auszug Kaiserin Helena |
| 10 |
Altar der
Corporis Christi Bruderschaft;
Verehrung des hl. Altarsakraments durch die vier Erdteile |
Zelebriert wird heute eigentlich nur mehr auf
dem Eisenerzaltar, der seit 1993 als Tischaltar im Chorraum steht und an den Bergbau
in und um Auerbach erinnern soll.

Die 7 Messbenefizien
in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer
Die Frühmesse
(primissaria)
war schon 1319 von Konrad Pogner auf seinem Totenbett gestiftet
worden "durch Vermächtnis
eines Gutes zu Gödersdorf mit Gülten an Korn, Gersten und Haber, dann Eiern,
"zehn Schilling der langen Haller und vier Gheiz (Kitzlein) zu Weihnacht
und vier zu Pfingsten". Zugleich verordnete der letzte Wille des Gründers,
dass "die Stiftsgüter von vier bescheidnen Männern (Pflegern) sollen verwaltet
werden und dass der Pfarrer keine Gewalt darüber habe, sondern die Messe alle
Tage gehalten und durch nichts gehindert werden solle". Als weitere Einkünfte
sind beurkundet: Eine Fleischbank, die "1367 Friedrich dem Schneider, Burger von
hier, um 6 Pfd. Haller vererbrecht" wurde; er solle dafür jährlich 25 Pfd.
Unschlitt (tierisches Fett) dem Frühmesser geben. Ebenso alt sind auch die Frühmessgüter
zu Bernreuth mit Getreidegülten, Fastnachtshennen, Eiern,
"Käsen (oder für
einen 6 Pfennige)".
Wie unsere anderen Benefiziatenmessen, so ging nun, obgleich sie nach dem ausdrücklichen
Willen der Stifter alle auf ewige Dauer gegründet waren (perpetuae missae),
auch die Frühmesse während der Reformation im Jahre 1538 wieder ein. Was die
Veränderung der Zeit von allen sieben Benfizien an ehemaligen Erträgnissen übrig
ließ, das wurde dann zur Pfarrei gezogen. So finden wir in den Pfarrurbarien
von 1772 die Ortschaften Bernreuth, Gödersdorf (Göttersdorf), Ornbach (Ohrenbach),
Ebersberg usw. mit
Getreidegülten, Herbst- und Fastnachtshennen, Käsen, Eiern, Linsen, Erbsen,
verschiedenen Geldzinsen usw. als tributbare Übergangsdenkmale der ehemaligen
Frühmesse.
Das Haus des Frühmessers lag neben der Kirche (Hausnummer 82, heute ein Teil
von Kirchstraße 2; altes Foto siehe unten) und wurde 1538 den Hebammen als Dienstwohnung übergeben.
Wenige Jahre später erwarb es der Stadtschreiber Hans Schmidt (1528-59), ehe es schließlich
1556 als "deutsches Schulhaus" umfunktioniert wurde.
 |
Das Haus des Frühmessbenefiziaten war Nummer 82
(heute ein Teil von Kirchstraße
2;
der andere Teil, Nr. 83, war das Haus der Pestlermesse; siehe weiter unten).
Haus 83 wurde zunächst an Stadtschreiber Georg Weber (1559-87) verkauft
und dann bei einer späteren
Umgestaltung
des deutschen Schulhauses ("Pröpstlschulhaus")
zu dessen
Vergrößerung verwendet.
|
Heute gehört das Anwesen Kirchstraße 2 der katholischen Kirchenstiftung.
Im
Erdgeschoss betrieb bis 2001 Anni Hartmann eine Buchhandlung mit religiöser
Kunst und Handarbeitsutensilien, im 1. Stockwerk befand sich die "Arche", ein
vielseitig genutzter Mehrzweckraum der Pfarrei.
1ak.jpg) |
Nach einer gründlichen Sanierung
und Renovierung des Gebäudes
in den Jahren 2008 und 2009
wird
es seit April 2009
nun ganz und intensiv als
Pfarrheim Arche
genutzt. (Der Eingang
befindet sich gegenüber
der Türe zur Sakristei.) |
Die Frauenmesse
wurde schon um 1374 gefeiert und war, wie alle sieben Benefizien, von hiesigen
Einwohnern gegründet. Der Benefiziat war bloß zum Frauenaltare in der
Pfarrkirche bestimmt und hatte, außer den Stiftsmessen zu Ehren unserer Lieben
Frau, alle Donnerstage auch eine Messe vom heiligen Leibe Christi zu singen und
mit dem heiligsten Sakramente eine feierliche Prozession zu halten. Dieser
Brauch der Sakramentsprozession am Donnerstag wird mit Abstrichen bis auf den heutigen Tag gepflegt.
Als Einkünfte werden im Jahre 1434 angegeben drei Güter zu Hormersdorf, dann
ein gleiches zu Reichenbach und ein Hof zu Horlach mit Gülten an Korn und
Haber, mit Käsen (oder für jeden 4 Pfennig), Herbst- und Fastnachtshennen
usw.. Das Haus des Frauenmessers war wohl auch in der heutigen Kirchstraße, also
ganz in der Nähe der Pfarrkirche.
1468 verkauften Bürgermeister und Rat als Patronatsherren der Frauenmesse mit
Wissen des damaligen Frauenmessers und mit Genehmigung des Bischofs von Bamberg
die Gült zu Horlach an den Michelfelder Abt Werner Lochner (1461-94).
"Diese Messe, die noch mit vielen anderen Renten und Einkünften ausgestattet
war, nahm 1555 Abschied, und die Überbleibsel ihrer Gefälle kamen später an
die Pfarrei."
Die Engelmesse
"Es war im Oktober 1380, als Kardinal Pileus mit seinem hohen Besuche unsere
Stadt beehrte. Die vornehme Gegenwart dieses großen Kirchenprälaten wurde von
den gesamten Einwohnern nicht nur mit dem lautesten Jubel der festlichsten
Feierlichkeiten verherrlicht, sondern auch durch eine religiöse Weihe
ausgezeichnet. Die heilige Gemeinde, vorzüglich aber eine Bürgersfrau in der
Bachgasse, die sogenannte schwarze Kodra, steuerten nämlich an Geld und Gut
zusammen und stifteten damit die Engelmesse in der Pfarrkirche, und der Kardinal
bestätigte nun am 18. Oktober 1380 die Gründung und Begüterung (Dotation)
dieser Messe mit größter Freude." Die entsprechende Urkunde stellte der
Kardinal an diesem Tag in Auerbach aus. Bischof Georg von Bamberg bestätigte
sie am 1. März 1518 von neuem und erklärte das Präsentationsrecht als dem
hiesigen Magistrate eigen.
Auch der Engelmesser wohnte in der heutigen Kirchstraße.
Die Einkünfte dieser Stiftung wurden von vier Vormündern verwaltet. So musste der
Schleichershof z.B. dem Engelmesser jährlich einen Tag
Fron mit Pferden
leisten. Abgaben kamen z.B. auch von Grundstücken in der Isenlohe und im
Grimmental und von Gärten beim Amberger Tor und am Grünhof.
Die Engelmesse wurde 1535 abgeschafft, und auch ihre Überreste kamen an die
Pfarrei.
Die Spitalmesse
wurde schon um 1384 mit der Gründung des Spitals gestiftet und eingeführt. Der
päpstliche Gesandte in Deutschland, Kardinal Julian, bestätigte 1434 der
hiesigen Gemeinde und dem Magistrate das Patronatsrecht.
Der Spitlmesser bezog Einnahmen z.B. aus Gütern zu Ranzenthal und
Steinamwasser,
und hatte neben einem eigenen Haus auch noch einen Garten hinter der Spitalkirche.
Dieses Anwesen (alte Hausnummer 150) "beim Neubauern" stand an der
Stelle des ehemaligen Pfarrsaales (erbaut 1946, 1995 abgebrochen) an der Stelle
des heutigen Alten- und Pflegeheims St. Hedwig. Seine letzten
Besitzer Georg und Franziska Schober, geb. Rupprecht aus Ortlesbrunn, siedelten
in das neuerrichtete Anwesen Michelfelder Straße 7 über. Erst im Jahre 1804
hatte Dechant Joseph Gabriel Neumüller (1799-1836 Stadtpfarrer in Auerbach)
den ehemaligen "Spitlpfarrhof" an Privatleute verkauft.
Weil diese Messe unter allen am reichsten ausgestattet war und nebst einem Verweser
auch noch Frau und Kinder ernähren konnte, ging sie auch während der Reformationszeit
nicht ein, sondern aus dem alten Messbenefizium wurde der Spitalpfarrer oder
Spitalprediger ohne Messe.
Die Pestlermesse
wurde nach ihrem Stifter Heinrich Pestler benannt und bestand schon vor 1434.
Ein anderer, seltner gefundener Name ist Lorenzimesse. Sie hatte von mehreren
großen Gütern in Hüll, Weidensees, Körbeldorf, Degelsdorf usw. Getreidegülten
und andere Einkünfte.
Eine besondere Pflicht dieser Stiftung war, jährlich an Martini (11. November)
ein Viertl Korn zu verbacken und das Brot an die Armen zu verteilen.
Mit dem Tode ihres letzen Inhabers Peter Kraus 1537 erlosch auch diese Stiftung.
Die Prädikaturstiftung
Dieses Benefizium wurde wohl 1435 vom hiesigen Magistrat und der Gemeinde
gestiftet, sowie von dem Nürnberger Bürger Nikolaus Schreiber und seiner Frau
Kunigunde mit 500 fl (florentiner, d.s. Gulden) und von der Auerbacher Bürgersfrau Adelheid Schiller mit
200 fl ausgestattet. Dieses Geld verwendete die Gemeinde mit zur Errichtung der Stadtmauer, verpflichtete sich aber im
Stiftungsbrief, es auf ewige Zeiten
mit 5 % zu verzinsen.
Die Urkunde von 1435 trug gleich drei Siegel, nämlich das des Pfalzgrafen Johann, das des Abtes Heinrich vom Kloster Sankt Aegyd zu Nürnberg und das der
Stadt Auerbach. Schließlich erfolgte 1436 noch die Bestätigung durch den
Bamberger Bischof Anton.
Zu gleicher Zeit wie in Auerbach entstanden auch in anderen größeren Orten Prädikaturstiftungen.
Die Prädikanten oder Prediger von Auerbach huldigten stets etwas freieren
Auffassungen als der jeweilige Pfarrer, und kamen deshalb öfter mit diesen in
Konflikt. Die Bürgerschaft stand wohl immer eher auf der Seite des Predigers,
der häufig auch in bürgerlichen Angelegenheiten ihr Vertrauter war.
Mit diesem Benefizium war eine Reihe von Pflichten verbunden:
1. Der Prediger soll wöchentlich in der Pfarrkirche auf dem
Barbaraaltar
drei Messen lesen.
2. Er musste jeden Sonn- und Festtag eine Predigt halten,
dazu in der
Fastenzeit jeden Montag, Mittwoch und Freitag und im Advent jeden
Freitag.
Die Uhrzeiten wurden von Pfarrer und Magistrat festgelegt.
3. Er musste öffentlich von der Kanzel der Stifter und Wohltäter
des Benefiziums mit einem frommen Gebete gedenken.
Die Prädikatur war reich mit Gütern und Abgaben ausgestattet und der Prediger
der angesehenste aller Benefiziaten. Dementsprechend war auch sein Haus, die
Nummer 53, heute Pfarrstraße 30, ein repräsentatives Gebäude.
|
 |
Nach dem Tod des letzten Predigers
Magister Heinrich Wiedemann
im Jahre 1625 - die Prädikatur hatte die
Reformation überdauert -
ging dieses Haus in den Besitz der Pfarrei über,
ehe
1842 die Stadt aus seinen Trümmern
die noch heute erhaltene Fronfeste
mit der
Gerichtsdienerwohnung baute.
Im Volksmund heißt es auch Heldmann-Haus,
weil hier ab 1934 die Arztpraxis von
Dr. Edith und Dr. Otto Heldmann war.
Ab 1958 stand das Haus teilweise leer,
bzw. wurde vom Eigentümer Stadt Auerbach
als Notunterkunft verwendet.
Nach einer gründlichen und aufwändigen Sanierung
dient dieses Haus seit 2002
Geschäfts- und Wohnzwecken.
(nach 3, Seite 171ff)
|
Die Michaelismesse
Hanns Stromer am Bach, Erhart Kraus, Elisabeth Kraus und Hanns Hammer stifteten
dieses Messbenefizium 1498, Erhart Kraus war selber Priester und auch der erste
Inhaber davon.
Auch dieser Benefiziat hatte wie seine Kollegen ein eigenes Haus in der heutigen
Kirchstraße,
dazu u.a. ewige Zinseinkünfte von mehreren Anwesen in Hartenstein, Altzirkendorf
und Penzenreuth. Der Michlsmesser musste aber auch z.B. im Winter ein Viertl
Korn zu Brot verbacken und dieses an die Armen verteilen, und jedem Schüler der
Lateinschule zu Allerheiligen einen Pfennig geben.
Nach knapp 50 Jahren erlosch die Michaelismesse 1547 wieder.
Zusammenfassend meint Neubig:
"So herrschte, ehe die Reformation kam, in unserer Pfarrkirche, wie in
einem großen erzbischöflichen Dom, ein fast beständiger und der lebendigste
Gottesdienst. Denn außer den Stiftsmessen der Benefiziaten hatte auch der
Pfarrer täglich das heilige Opfer der Erlösung zu feiern - alles nach einer
bestimmten Zeit und Meßordnung. Zudem waren täglich die Früh- und Nachmittagsandachten
mit Chorsingen, Beten und Vespern usw. in der Pfarrkirche vorgeschrieben,
denen die sämtlichen sieben Benefiziaten beiwohnen mußten, weil sie ohnehin
keine pfarrlichen Verrichtungen und Rechte hatten." (S. 64)
verwendete und weiterführende Quellen
| 1 |
Neubig, Johannes, Auerbach, die ehemalige Kreis- und Landgerichts-Stadt in der
Oberpfalz, Auerbach 1839 |
| 2 |
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Benefizium |
| 3 |
Kugler, Hans-Jürgen, Auerbach in der
Oberpfalz - Die Geschichte seiner Häuser und Familien, Band 1, Auerbach 2008 |
letzte Bearbeitung dieses Artikels am 28.
Mai 2022

 |
Praetorius,
Michael (1571/72 - 1621)
Vater unser im Himmelreich |

|
Für Ergänzungen, Korrekturen usw.
bin ich sehr dankbar.
Hier können Sie mich erreichen!
|

|
 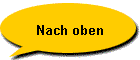
|