|
| |
Hohe Investitionen
der N-Ergie Nürnberg
in die Trinkwasseranlage Ranna
(Sept. 2016
SRZ)
und die Leitung nach Nürnberg
(2024
NN)


100 Jahre
Trinkwasser für Nürnberg
aus Ranna
Seit dem 18. Juli 1912, also seit über 110 Jahren, bezieht die Stadt Nürnberg einen großen
Teil ihres
Trinkwassers - pro
Sekunde sind es rund 450 Liter - aus Ranna. In einer ca. 45 km langen Leitung
fließt das kostbare Nass ohne jeglichen Einsatz von Pumpen im freien Gefälle
aus dem "Dreiländereck" Mittelfranken, Oberfranken und Oberpfalz in die Frankenmetropole, die damit rund 40 % ihres
Trinkwasserbedarfs deckt. Seit 1981 bezieht auch die Stadt Auerbach ihr Wasser
aus Ranna.
Zum Jubiläum informierte die
Ausstellung
100 Jahre Ranna - Trinkwasser für Nürnberg
Video

Seit 1981 bezieht auch die Stadt
Auerbach ihr Wasser
von der EWAG bzw. heute N-ERGIE aus Nürnberg,
genauer von deren Wasserwerk in Ranna

Trinkwasserversorgung
(Bayern)
Die Gemeindeordnung (GO) in Bayern besagt über die
Versorgung mit Trinkwasser: "(2) Die Gemeinden sind
unbeschadet bestehender Verbindlichkeiten Dritter in den Grenzen ihrer
Leistungsfähigkeit verpflichtet, die aus Gründen des öffentlichen Wohls
erforderlichen Einrichtungen zur Versorgung mit Trinkwasser herzustellen und zu
unterhalten."
(GO
Artikel 57)
In Nürnberg
wurde die Trinkwasserversorgung 1856 in die Verantwortung
der
Stadt übernommen. Vorher gab es etwa 1.200 Brunnen in der Stadt Nürnberg.
Darunter waren und sind immer noch einige besondere
Brunnen.
Diese Brunnen lieferten nicht immer Trinkwasser in guter Qualität und in der benötigten
Menge. Eine der Folgen war
1854/55 eine Cholera-Epidemie.
Bedingt auch durch die steigende Einwohnerzahl - von ca.
25.000 im Jahre 1810 war die Bevölkerung Nürnbergs auf ca. 230.000 anno 1899
angewachsen - und den
allgemein höheren
Wasserverbrauch
(Bayern) - am 1. Juni 1901 waren es z.B. 29.400 m³
- (1, Seite 236) beschloss die Stadt Nürnberg Anfang Dezember 1900 den
weiteren Ausbau ihrer Wasserversorgung.
Die Vorarbeiten
"Die Untersuchungen bei Ranna zeigten fortgesetzt günstige Ergebnisse in
chemischer und bakteriologischer Beziehung, sowie hinsichtlich der Wassermengen.
Die mittlere Ergiebigkeit der drei Quellen (Haselhofquelle mit 233, Felsenquelle
mit 7 und Franzenweiherquelle mit 10 Sekundenlitern) wurde zu 250 Sekundenliter
festgestellt. (1, Seite 237) Ein Gutachten vom 24.7.1903 gipfelte in der
Feststellung: "... Daraus geht hervor, daß das Wasser des Quellgebietes
bei Haselhof in chemischer und bakteriologischer Hinsicht nicht nur vollkommen
einwandfrei ist, sondern daß auch seine Beschaffenheit in Bezug auf Temperatur
und Härte eine sehr gute genannt werden kann. Bei der Verwendung dieses Wassers
für die Wasserversorgung Nürnbergs könnte die letztere keine bessere
Erweiterung als vorgeschlagen erfahren." (1, Seite 238)
Bau der Wasserleitung
Bereits im Jahre 1902 hatte die Stadt Nürnberg mit
dem Erwerb der benötigten Grundstücke begonnen. Dieser wurde nun, vor allem
auch für die geplante Leitung, zügig fortgesetzt, teilweise auch über
Zwangsenteignungsverfahren.
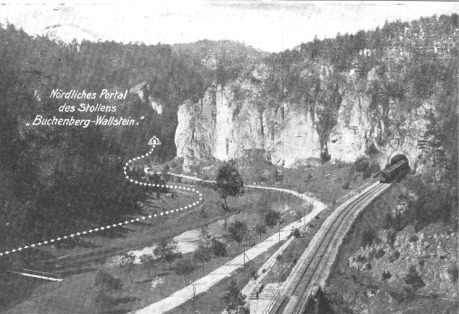
Vor dem
eigentlichen Baubeginn der Quellfassung und der Leitung nach Nürnberg mussten
neben der Planung auch umfangreiche und teilweise recht schwierige Verhandlungen
wegen der betroffenen Grundstücke geführt werden.
Dieses Foto, eine alte Postkarte die 1912
anlässlich der Inbetriebnahme herausgegeben wurde, zeigt den Streckenabschnitt
"Roter Fels" bei Rupprechtstegen.
Die Bahnlinie (rechts) von Nürnberg nach Bayreuth durch das Pegnitztal war
bereits am 15. Juli 1877 in Betrieb gegangen.
Die Arbeiten für den Bau der Quellfassung im
Haselhofweiher begannen am 7. April 1905 mit dem Ausheben und Abtransportieren
des Bodens für das Fassungsbecken mit einer Fläche von ca. 20.000 m².

Auf
der Sohle des ausgehobenen Quellfassungsbeckens wurden zwei Rohrstränge für
das Sammeln des Wassers eingebracht, die aus 900 mm lichten Zementröhren mit seitlichen Schlitzen
bestanden. Das ganze Becken verfüllte man anschließend mit Dolomitsteinen, deren
Größe von unten nach oben abnahm. Über sie oberste Feinschotterschicht
(2-6 cm Korngröße) wurde eine 30 cm hohe Sandschicht aufgebracht, die
schließlich mit 20 cm Eisenbeton abgedeckt wurde. Darüber wiederum wurde noch
1,50 hoch Erdreich geschüttet.
Im Hintergrund ist das kurz darauf abgebrochene Haselhofanwesen zu erkennen.
(Foto 2)
Ende des Jahres 1908 wurde mit dem Bau der
Leitung begonnen. Die beiden folgenden Fotos zeigen die Errichtung des
nördlichen (links) und des südlichen (rechts) Mundlochs des Stollens
Gotthardt-Höllberg, die von beiden Seiten her gleichzeitig betrieben wurde.
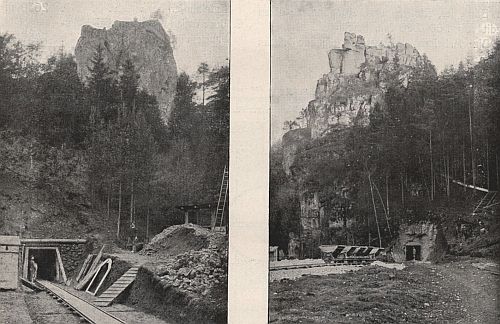
Beim
Bau dieses Stollens bei Lungsdorf durch das Dolomitgestein kamen die Arbeiten am
Tag von beiden Seiten jeweils 0,72 m voran. Am 16. September 1909 erfolgte
schließlich der Durchschlag. (Foto 2)
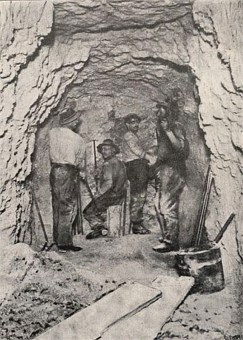 |
Ähnlich verlief auch die Errichtung
der fünf anderen Bergdurchbrüche
(Kugelberg zwischen Neuhaus und Rothenbruck,
Haidenhübel bei Velden,
Hufstätte
bei Lungsdorf,
Buchenberg-Wallstein
zwischen Rupprechtstegen und Artelshofen
und
Viehberg bei Hersbruck):
Große Teile des Vortriebs in den Fels mussten von den
Männern
in schwerer Handarbeit erledigt werden. (1, Seite 287; Foto 2) |
Inbetriebnahme 1912
"Während das bei Ranna gefaßte Wasser schon im Jahre 1906 in die Pegnitz
abgeleitet werden konnte, hat die betriebsfertige Herstellung der
Zuleitungsanlagen von Ranna nach Nürnberg wesentlich längere Zeit in Anspruch
genommen, was in erster Linie durch die Schwierigkeiten bei der Herstellung des
Stollens Buchenberg veranlaßt wurde. Am 16. November 1911 ging man daran, den
oberen Teil der Zuleitung von Ranna bis zum Stollen Buchenberg bei
Rupprechtsstegen in Betrieb zu nehmen, wobei sich keine Störung ergab; das
Wasser floß seitdem dort in die Pegnitz ab. Die Inbetriebnahme der ganzen
Anlage und die Versorgung der Stadt mit Wasser von Ranna begann am 8. Juni
1912." (1, Seite 313)
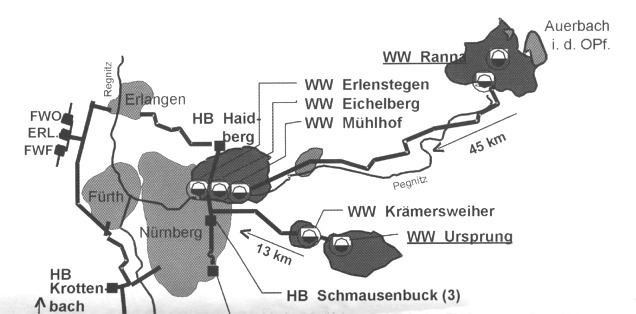
(WW bedeutet Wasserwerk, HB Hochbehälter) (3, Seite 45)
"Rund 40.000 m³ bestes Trinkwasser kommen ohne
Aufbereitung und ohne Energieeinsatz aus dem „Veldensteiner Forst“. Die 45
km lange Leitung aus dem Quellgebiet „Ranna“ … folgt seit 1912 mit sechs Dükern
(Anm.: Ein Düker ist ein
Kreuzungsbauwerk, mit dem innerhalb eines Rohrnetzes ein Hindernis unterfahren
wird, z. B. ist eine Flussunterquerung mit einer Rohrleitung ein Flussdüker.)
und sechs bis zu 2,4 km langen Stollen weitgehend dem Lauf der Pegnitz
und mündet in dem 75.000 m³ fassenden Hochbehälter „Haidberg“ am nördlichen
Stadtrand. Ein Teil des Quellwassers wird auch in den oberhalb des Tiergartens
gelegenen Speicher am „Schmausenbuck“ geleitet. Auf dem zentralen Hausberg
der Nürnberger befinden sich seit 1918 drei Behälter mit einem Speichervolumen
von insgesamt ca. 70.000 m².
" (3, Seite 45)
"Eine
deutschlandweit einmalige, geniale Anlage:
Bis
Hersbruck fließt das Wasser mit einer Geschwindigkeit von 50 Zentimetern pro
Sekunde in einem offenen Kanalsystem, das teilweise in Tunneln unter Bergen
hindurchführt und mehrmals die Pegnitz unterquert. Erst hinter Hersbruck wird
der hydrostatische Druck so groß, dass man das Wasser in einer 90 Zentimeter
dicken Gusseisenleitung bändigen muss." (4, Seite 2)
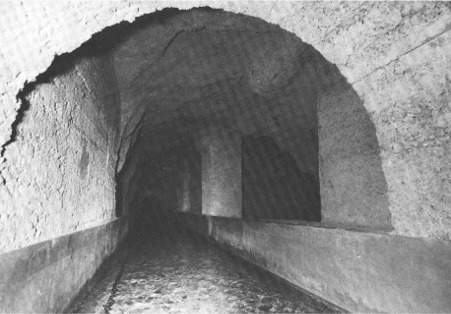
"Eine schmale Wanne im mit Beton ausgekleideten Fels: so
sieht der Stollen Buchenberg-Wallenstein aus." (5, Seite 32)
"Etwa
alle zwei bis drei Jahre steigen Mitarbeiter ... ins Schlauchboot und
kontrollieren den Zustand des Bauwerkes - der Fels drumherum arbeitet
schließlich manchmal. ... Der Stollen ist ausbetoniert ... In den Stollen ist
eine Betonwanne eingelassen, in der das Wasser fließt. ... Wasser gibt es auch
um den Stollen herum genug: Für dieses Bergwasser wurde ein zweiter, kleinerer
Stollen angelegt, unterhalb des Trinkwasserkanals. Von dort wird es nach außen
abgeleitet." (5, Seite 31 f)
"Die
46 Kilometer lange Rannaleitung war eine ingenieurtechnische Meisterleistung.
Das gewonnene Trinkwasser sollte ohne Energieeinsatz im freien Gefälle in die
Stadt oder in den Hochbehälter am Schmausenbuck fließen. Bei einer
Höhendifferenz von nur 25 Metern war höchste Präzision erforderlich. Die Leitung
folgt größtenteils dem Verlauf der Pegnitz und unterquert sie sechs Mal. Darüber
hinaus wurden sechs Stollen mit einer Gesamtlänge von 6.930 Metern gegraben. Das
erste Trinkwasser konnte am 8. Juni 1912 erfolgreich nach Nürnberg geleitet
werden – ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte der Stadt."
(Quelle)
Wasserschutzgebiet
= Naturschutzgebiet
Natürlich hat es den unmittelbar Betroffenen sehr weh getan, als sie im Zuge
der Errichtung und Ausweitung des Wasserschutzgebietes für die Ranna-Quellen
z.B. ihre angestammten Heimatorte Fischstein, Rauhenstein
usw. verlassen mussten oder die Felder nicht mehr in der bisher gewohnten Form
bearbeitet werden durften.
Aber: "Ein riesiges Wasserschutzgebiet rund um die Pegnitz, das
gleichzeitig auch Naturschutzgebiet ist, wird von n-ergie in Zusammenarbeit mit
dem Bund Naturschutz betreut und ist unter anderem Reservat für seltene
Wasservögel." (4, Seite 2) Auch als Naherholungsgebiet ist die erweiterte Wasserschutzzone
von Bedeutung, insbesondere auch die Kammerweiher.
verwendete und weiterführende Quellen
| 1 |
Die Wasserversorgung der Stadt Nürnberg von
der reichsstädtischen Zeit bis zur Gegenwart, Festschrift zur Eröffnung
der Wasserleitung von Ranna, Nürnberg 1912 |
| 2 |
Hundert Jahre Ranna-Wasser in Nürnberg, Pressemitteilung
der N-ERGIE vom 5.4.2005 |
| 3 |
Mohr, Ulrich,
150 Jahre öffentliche
Trinkwasserversorgung in Nürnberg, in DWA Landesverband Bayern,
Mitglieder - Rundbrief 2/2006, Seite 44 ff
|
| 4 |
Mohr,
Harald, Wasser für die Frankenmetropole, in OWZ, Ausgabe AM-AS, 6./7.
September 2006, Seite 1 f
|
| 5 |
Schwab,
Dieter, Wasser für Nürnberg, in Nürnberg heute, Ausgabe 37/1984, Seite 31
ff |
| 6 |
Einige Millionen Euro schlummern unter Rannas
Erde, Artikel NN,
9. September 2016 |
| 7 |
Bis zu 164 Liter pro Sekunde, Artikel SRZ,
12. September 2016 |
| |
|
| |
Die Rannaleitung (Wikipedia) |
| |
N-ERGIE |

 |
Wassermusik von Georg Friedrich Händel
(1685-1759) |
letzte Bearbeitung dieses Artikels am 7.
Januar 2025

|
Für Ergänzungen, Korrekturen usw.
bin ich sehr dankbar.
Hier können Sie mich erreichen!
|

|
 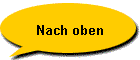 |