|
| |
Wallfahrtskirche St.
Laurentius
Weißenbrunn
Immer
am 2. Sonntag im August
findet in Weißenbrunn (Karte,
oben Mitte),
Pfarrei Neuzirkendorf,
das Patrozinium des hl. Laurentius statt.
9.00 Uhr Festgottesdienst
anschließend Bewirtung (Mittagessen!)
14.30 Uhr Festandacht
anschließend Ausklang mit Bewirtung
Der Reinerlös ist für den Erhalt der Kirche.
|

Sicher
ist, dass es wohl schon lange vor der Gründung des Bistums Bamberg (1007) eine
Kapelle beim weißen Brunnen gab, denn als sie im Jahre 1196 samt ihren Zugehörungen
ans Kloster Michelfeld kam, war sie
praktisch bereits schon wieder eingegangen.
1196 zum Kloster Michelfeld
Diese erste Kapelle beim Brunnen war sicher größer als die,
welche wir heute über der Quelle kennen,
denn sonst wäre sie wohl zu unbedeutend gewesen. Auf ausdrücklichen Wunsch von
Bischof Otto II. wurde nämlich im Jahre 1196 durch das Kloster Michelfeld unter
Abt Adalbert II. (reg. 1196-1209) die Kapelle des heiligen Laurentius wieder
hergestellt. Ihr Standort könnte allerdings etwas näher an der Quelle gewesen
sein als es die heutige Kirche ist.
Im Jahre 1420 war wohl schon wieder ein Neubau oder zumindest eine Erweiterung
errichtet worden, denn am Feste des heiligen Gallus (16. Oktober) weihte der
Bamberger Weihbischof die Kapelle „Zu dem Pozmanns, und ein Altar wurde der
Hl. Dreifaltigkeit, Marien, dem hl. Lorenz und vielen anderen Heiligen
geweiht“ und auf ewige Zeiten mit einem Ablass von 40 Tagen ausgestattet. (9)
Kurz vor dem Jahre 1500 war die Kapelle zusammen mit dem Gut Buzmanns schon
wieder eine Ruine. 1496 wurde das Heiligtum des hl. Laurentius unter Abt
Friedrich Trautenberger (1494-1511) von Grund auf wieder neu errichtet. Nicht
nur der oben genannte Bauer Fronhöfer wurde damals vom Kloster verurteilt,
statt einer anderen Strafe zum Bau der Kirche einen Beitrag zu leisten, sondern
auch zahlreiche andere „Missetäter“ der umliegenden Orte, über die ja das
Kloster Michelfeld die niedere Gerichtsbarkeit innehatte. Am 10. November 1496
wurde die Kirche schließlich samt ihren 3 Altären neu eingeweiht.
Untergang
im 16./17. Jahrhundert
Das mit viel Mühe wiedererbaute Gotteshaus am weißen Brunnen stand aber nur kurze Zeit in Blüte,
denn in der Reformationszeit während der
protestantischen bzw. kalvinischen Ära war es
praktisch dem Untergang überlassen. Als 1556 die kurfürstliche Regierung
befahl, alle überflüssigen Kapellen und Feldkirchen niederzureißen,
berichtete der Auerbacher Landrichter Wolf von Rabenstein (1554-59), dass die
meisten dieser Kirchen nicht abgebrochen zu werden brauchen, da sie von selbst
einfallen und teilweise schon eingefallen sind. In seinem Bericht nennt er
sieben solcher Kirchen, darunter auch eine Kapelle bei Thurndorf, der Putzmanns
genannt, „in einer Einöde liegend, die selbsten abgeht“. (4) Man kann davon
ausgehen, dass die Kirche in den folgenden Jahrzehnten wohl vollständig zu
Grunde ging und bei Wiedereinführung der katholischen Lehre durch Kurfürst
Maximilian 1628 nur mehr ein kümmerlicher Steinhaufen war.
Neubau
zu Beginn des 18. Jahrunderts
Sicherlich bedingt durch die große Not der Bevölkerung und den langsamen Wiederaufbau
des Klosters Michelfeld sollte es noch über 100 Jahre dauern, bis im Jahre 1736
die gegenwärtig noch vorhandene barocke Wallfahrtskirche Sankt Laurentius am
Weißenbrunnen „nach Plänen von Balthasar Neumann“ (10)
vom Michelfelder Abt Heinrich
Harder (reg. 1721-38) und dem sehr kunstverständigen Benediktinerbruder Anton
Denzler erbaut und feierlich eingeweiht werden konnte.
 |
Die Wappen
des Klosters Michelfeld
und des Abts Heinrich (rechts)
sind über dem Bild
des Hochaltars
der Laurentiuskirche
Weißenbrunn
zu sehen.
|
Die Brunnenkapelle wurde wohl schon
1709 unter Abt Wolfgang Rinswerger (reg. 1707-21) erbaut.


Solange das Kloster Michelfeld bestand, wurden in der Kirche am Weißenbrunnen häufig
Messen gelesen, besonders im August und September. An Laurentius
(10. August), Maria Himmelfahrt
(15. August) und Bartholomäus
(24. August) wurden von den Benediktinerpatres besondere Festgottesdienste abgehalten.
Bei der Säkularisation fiel
auch diese Kirche an den
Staat und sollte 1803 eigentlich abgebrochen werden. Wer sie damals vor dem
Untergang rettete, ist nicht bekannt.
1895 wurden auf Drängen des königlichen
Bezirksamtes Eschenbach wenigstens die größten Schäden des Gotteshauses von der Gemeinde
Neuzirkendorf ausgebessert, da die Kirche selber dazu finanziell nicht in der
Lage war. Ein weiterer Verfall des altehrwürdigen Heiligtums wurde dadurch zwar
etwas gebremst, jedoch nicht aufgehalten.
Rettung
durch Hans Haßler
Bei einer Ortsbesichtigung durch Sachverständige des
damaligen Bezirksamtes Eschenbach im April 1930 wurden der Bauzustand und die
unbedingt zu behebenden Schäden festgestellt.

Kirche um 1930, von Norden her gesehen
Da
die Laurentiuskirche danach wegen Baufälligkeit polizeilich gesperrt wurde, bot
die Erzdiözese Bamberg das Gotteshaus 1933 zum Verkauf an; lediglich die beiden
Statuen der Bistumspatrone Heinrich und Kunigunde sollten erhalten bleiben
und ins Diözesanmuseum
gebracht werden.
Vor allem durch den Einsatz des späteren Neuzirkendorfer Bürgermeisters Hans
Haßler (1904-81) wurde ein Abriss verhindert.
|
Hans Haßler (1904-1981)
von Neuzirkendorf,
Landwirt des Anwesens Nr. 14,
von 1945 bis 1978 Bürgermeister
seiner Heimatgemeinde,
rettete durch seinen Einsatz
die Weißenbrunner Kirche
vor dem Abriss. |
 |
Doch auch jetzt konnten unter
Einschaltung des Denkmalschutzamtes nur notwendigste Erhaltungsmaßnahmen getätigt
werden, denn der 2. Weltkrieg band die finanziellen Kräfte.
 |
„Zu allem Unglück
wurde das fast baufällige Gotteshaus
am 19.4.1945,
als
auch Troschenreuth
in Flammen aufging,
noch von einer Granate getroffen.
Dach und
Decke am Ende des Langhauses
wurden stark beschädigt.
|
Gleich nach der Währungsreform vom
20. Juni 1948 sammelte Bürgermeister Haßler Geld, um dringendst notwendige
Instandsetzungsmaßnahmen durchführen zu können. Für den
Wiederaufbau erhielt die Pfarrei von der Erzdiözese Bamberg keinen Pfennig.
1959 wurden dann drei neue Glocken angeschafft, die zunächst im Dachgebälk über der
Sakristei aufgehängt wurden. 1974 bis 1976 wurde eine Generalsanierung durchgeführt,
bei der u. a. das Dach und die Innenpflasterung erneuert und die Altäre usw.
restauriert wurden. 1974 erfolgte auch der Stromanschluss, durch den dann 1985
die Elektrifizierung des Geläuts möglich wurde.

Kirche 1980 - noch ohne Turm
"So
konnte Hans Haßler an seinem Lebensende mit Recht stolz über sein gelungenes
Werk sein.“ (11)
a.jpg) |
Ludwig Sporrer (1933-2021)
Ganz in die Fußstapfen seines Schwiegervaters Hans Haßler trat Ludwig Sporrer,
geboren in Hagenohe, gestorben in
Neuzirkendorf.
Er heiratete die Tochter Christine (1942-2018). Mit ihr hatte er 3
Söhne.
Ludwig Sp. war ab 1975 über drei Jahrzehnten als Mesner und als Kirchenpfleger
tätig.
In all den Jahren war er wirklich unermüdlich
für den Erhalt der Laurentiuskirche besorgt.
1990 wurde das gesamte
Kircheninnere aufgefrischt und der Außenputz saniert.
Zuletzt wurde die Kirche kurz vor der Jahrtausendwende innen und außen gründlich
renoviert.
Im Heiligen Jahr 2000 schließlich konnte am Patronatsfest (13.
August 2000)
der für rund 130.000 DM angefertigte Zwiebelturm geweiht und
aufgesetzt werden.
2004 wurde die Orgel auf seine Initiative installiert. |
Leider suchten 1971 und 1981 Diebe die Laurentiuskirche heim und entwendeten z.
T. wertvolle sakrale Gegenstände wie mehrere barocke Kerzenständer.
Kirchenbeschreibung

„Großer
Bau von 1736 ... mit eingezogenem, dreiseitig geschlossenem Chor. Das Langhaus
hat drei Joche.“ So heißt es in dem Standardwerk „Die Kunstdenkmäler des Königreichs
Bayern“ über die Weißenbrunner Kirche. (1) Nüchtern und sachlich, jedoch
etwas ausführlicher ist die Beschreibung von 1960 im Realschematismus der Erzdiözese
Bamberg, in welchem alle Pfarreien und ihre Kirchen aufgeführt sind. „Große
Barockkirche von 1736 ... ; mit eingezogenem Chor, hell, weit, kalt, keine
Heizung, kein elektrisches Licht, gute Akustik; 3 Altäre, gerade Kommunionbank
unter Chorbogen, 4 offene Beichtstühle, keine Kanzel, kein Taufstein, neues
Gestühl, hölzerne Westempore, keine Orgel; ... ; 200 Sitzplätze, 300 Stehplätze.
- Außen: Eingezogener Chor mit dreiseitigem Schluß, barockes Südfenster, 1
Westeingang, 2 Seiteneingänge; gemeinsames, hohes, abgewalmtes Satteldach; am
Chor nördlich angebaut zweigeschossige Sakristei. Innen: Saalkirche, durch
verkröpfte Pilaster in 3 Joche geteilt, Tonnengewölbe mit Stichkappen,
steinerne Bodenplatten; Chor mit Fenster zum Obergeschoß der Sakristei, 1 Stufe
über Langhaus erhöht; Gesamtmaße: Länge 33 m, Breite 11 m, Höhe 9 m. -
Ausstattung einheitlich barock, nach 1736; Hochaltar: S. Laurentius,
eindrucksvoller Architekturaufbau mit 2 Pilastern und 4 Säulen, verkröpftem
Gebälk, im Aufzug zwischen Voluten Strahlenglorie, Ölgemälde des Heiligen,
zwischen den Säulen Monumentalstatuen Heinrichs und Kunigundens;" (12)
"linker
Seitenaltar: Marienaltar; rechter: Bartholomäusaltar; einfach, übereck
gestellte große Altarblätter, hochovale Bildfelder im Aufzug; 4 gleichartige
Beichtstühle mit geschwungenen Profilen, Gitterwerk und barockes Rankenwerk als
Bekrönung.“ (12)
 |
Der
Turm
wurde, wie schon gesagt,
im August 2000
aufgesetzt.
Seither haben
die vier Glocken
einen würdigen Platz
und rufen die Menschen
zu den Gebetszeiten
und den Gottesdiensten.
|
|
2004
wurde eine Orgel
in der St. Laurentiuskirche
Weißenbrunn
installiert.
Sie unterstützt
den Gesang der Gläubigen,
ermöglichte aber auch schon
größere Konzerte. |
 |

verwendete
und weiterführende Quellen
1
|
Hager,
Georg, Die Kunstdenkmäler des Königreichs Bayern, Band XI, S. 159 f
|
2
|
Böhm,
Leonore, Leben und Sterben des hl. Laurentius, in der Neue Tag vom
20.08.1983
|
3
|
Looshorn,
Johann, Die Geschichte des Bistums Bamberg, Band I, S. 411
|
4
|
Schnelbögl,
Fritz, Auerbach in der Oberpfalz, Seite 301, 145
|
5
|
Monumeta
Boica, Band XXV, verschiedene Seiten
|
6
|
Bauer,
Heinrich, Geschichte der Stadt Pegnitz und des Pegnitzer Bezirkes, S. 72
|
7
|
Regesta
Boica, Band XII, Seite 353
|
8
|
Köstler,
Joseph, Bd. XXII der handgeschriebenen Chronik der Stadt Auerbach, S. 97
ff
|
9
|
Looshorn,
Johann, Die Geschichte des Bistums Bamberg, Band VI, S. 114
|
10
|
Lampl,
Sixtus, Denkmäler in Bayern, Band III Oberpfalz, Seite 178
|
11
|
Graf,
Alfred, Kloster Michelfeld erbaute die Laurentiuskirche, in der Neue Tag
vom 10.08.1991
|
12
|
Realschematismus
des Erzbistums Bamberg, Erster Band, Seite 205
|
13
|
Neumann,
Bruno, Chronik des Ortes Zirkendorf, Skriptum von 1953, ohne Seitenzahlen
|
|
|
|
|
|
Weber, Rudolf, Chronik der Pfarrgeneinde Neuzirkendorf, Neuzirkendorf 1995 |

 |
Luigi Cherubini,(1760-1842)
Agnus Dei aus Requiem C |
letzte
Bearbeitung dieses Artikels am 26. Juni 2022

|
Wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen möchten,
können Sie mich hier
oder unter 09643 683 erreichen. |

|
 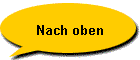 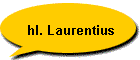
|